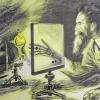Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?“, so fragt der Psalm 8. Für Kant gehörte diese Frage zu den vier großen Grundfragen der Philosophie. Er beschreibt den Menschen als das „Wesen der Mitte“ – er war nicht schon am Anfang des Kosmos und er wird auch nicht am Ende sein, er hat zwar Macht und Kontrolle über einen Teil seiner Umwelt, in keinem Fall aber über das All. Er ist nicht göttlich oder übermächtig. Im Umfeld des sogenannten Kategorischen Imperativs kommt es immer wieder zu dem Grundsatz „Menschsein heißt handeln müssen.“
Dieser Frage widmet sich eine gemeinsame Ausstellung des Schulmuseums Lohr-Sendelbach und der Pfarrei St. Michael. Denn die Frage „Was ist der Mensch?“, ist nicht nur für die Philosophie die zentrale Herausforderung, sondern auch für Naturwissenschaften, Medizin, Kunst und für die Religion.
Der Künstler Michelangelo, Schöpfer der einzigartigen Fresken in der Sixtinischen Kapelle in Rom, fühlte sich zeitlebens zum Bildhauer berufen. Die Bildhauerei allein konnte ihm Antwort geben auf die Frage, was den Menschen ausmacht. Aus Stein befreite er Idealkörper und beseelte Menschen wie den David, die herausragende Skulptur der Menschheitsgeschichte, die heute in der Galleria dell'Accademia in Florenz steht. Michelangelo war versessen auf das Studium des menschlichen Körpers: Muskeln, Adern, Sehnen – unzählige Skizzen zeugen von Michelangelos Wunsch, den idealen Körper darzustellen, der aber nicht gefühls- und seelenlos sein durfte. Gefühle, ideale Schönheit, aber auch Schmerz und Zerrissenheit – all das gelingt Michelangelo in seinen aus hartem Marmor geschaffenen Skulpturen darzustellen. Die Kunst schaut tiefer und lässt im Gefüge des Körpers die Gefühlswelt und die Größe des Menschen, Geist und Seele, erkennen.
Die Biologie kennt den modernen Menschen seit rund 200 000 Jahren und vermutet seinen Ursprung in Afrika, möglicherweise in Äthiopien. Charles Darwin hat mit seinen Forschungen gezeigt, dass der Mensch Teil der gesamten Evolution ist und nicht fertig „vom Himmel“ fiel. Gene, Zellen, DNA bilden heute das Forschungsfeld der Humangenetik.
„Was ist der Mensch?“ Die Antwort auf diese Frage benötigt Blickwinkel aus der Philosophie, der Biologie, der Gesellschaftslehre, der Religion. Immer aber ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Die drei Begriffe „Körper“, „Geist“ und „Seele“ bilden dabei einen klassischen Rahmen für ein ganzheitliches Verstehen des Menschen. Dieses Verständnis wurde schon im griechisch-antiken Sprachgebrauch so verwendet. So wurde für den aufrecht schreitenden Menschen der Begriff „Anthropos“ verwendet, für den Körper der Begriff „Soma“ und für das Fleisch und den vergänglichen Körper der Begriff „Sarx“.
Die biblische Überlieferung kennt zwei Arten von Schöpfungsaussagen: die Menschenschöpfungsüberlieferung und die Weltschöpfungsüberlieferung. Beide bilden eine eigenständige Tradition und gehören nicht von Anfang an zusammen. Die ältere Überlieferung vom Werden des Menschen gründet in seinem Erleben und der daraus entspringenden Frage nach seinem eigenen „Woher komme ich“. So hatte in der biblischen Überlieferung die Frage nach dem Menschen seinen ursprünglichen „Sitz im Leben“ im sogenannten Klagegebet. Der Beter erinnert Gott an seine Erschaffung und formuliert daraus die Bitte, dass Gott ihn doch jetzt nicht allein lasse, sondern ihn rette aus seiner Not. Die Erinnerung an die Weltschöpfung war dagegen fester Bestandteil des Lobgebetes der ganzen Gemeinde.
Die Bibel verschweigt Glück und Leid des Menschen nicht. Sein Leben erst ist der Boden für die Entfaltung des Glaubens an den Gott, der ihn geschaffen, aus Ägypten gerettet und in das Land geführt hat, das er schon Abraham verheißen hat.
Auch für die Bibel ist die Frage „Was ist der Mensch?“ eine zentrale Herausforderung für das Denken und den Glauben. Sie versteht ihn ganzheitlich. Nur so kann er mit allem, was ihn prägt, Abbild Gottes sein und zu seiner Ehre leben: „Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott.“ (Psalm 84,3)
Das Schulmuseum Lohr-Sendelbach und die Pfarrei St. Michael wollen in einer gemeinsamen Ausstellung im Fischerhaus am Kirchplatz zeigen, wie diese ganzheitliche Sicht des Menschen auch schon vor hundert Jahren die Entwicklung eines Menschen formte. Aus dem Bestand der Familie Hettiger werden zum Beispiel Erinnerungsgegenstände gezeigt, die an wichtigen Punkten auf dem Lebensweg eines Menschen ihn körperlich, geistig und religiös fördern sollten. Die Entwicklungsstadien des Körpers werden mit Bildungsinhalten der Schulzeit und der Katechese in der religiösen Bildung beziehungsweise dem Empfang der Sakramente verbunden.
Neben einem Überblick über den Unterricht im Blick auf den menschlichen Körper finden sich zahlreiche Ausstellungsstücke, die das Denken und die Volksfrömmigkeit jener Zeit beleuchten: Schulbilder, Literatur, Hausaltäre und Andachtsgegenstände.
Eröffnung ist am Sonntag, 13. April, 11 Uhr. Die Ausstellung ist bis 4. Mai an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.
ONLINE-TIPP
Der Text der Autoren musste für die Zeitung leider deutlich gekürzt werden, kann aber vollständig nachgelesen werden im Internet unter www.mainpost.de/regional/main-spessart