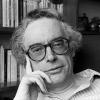Im Alter von 83 Jahren ist am 22. April 2019 in Basel der bekannte deutsche Schriftsteller Dieter Forte gestroben. Was wenige wissen: Forte war 1942/43 mit seiner Mutter und seinem Bruder, gemeinsam mit anderen Müttern mit ihren Kindern aus dem durch Bomben zerstörten Düsseldorf in Rohrbach untergebracht. Seinen Aufenthalt im Haus der Gastwirtsfamilie Riedmann hat er in seinem autobiografischen Roman "Das Haus auf meinen Schultern" literarisch verarbeitet. Als wortmächtige Chronik der Kriegs- und Nachkriegszeit hat dieses Werk der zeitgenössischen deutschen Literatur mehrere Auszeichnungen erhalten.
Der 1935 in Düsseldorf geborene Schriftsteller verließ seine Heimatstadt und zog nach Basel, als ihm 1970 die Uraufführung seines Theaterstücks "Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung" im Düsseldorfer Schauspielhaus verwehrt wurde. In Basel wurde das Stück ein Welterfolg, von 50 Bühnen gespielt, in neun Sprachen übersetzt. Forte blieb in Basel, wurde Hausautor des dortigen Theaters als direkter Nachfolger von Friedrich Dürrenmatt. Der Schriftsteller verfasste zahlreiche Theaterstücke, Fernsehfilme und Hörspiele und Prosadichtung. Mit zahlreichen Literaturpreisen wurde sein Lebenswerk honoriert.

Vor den Bombenangriffen im Rheinland evakuiert
Nach 1980 arbeitete Forte an einer Romantrilogie über die italienische Seidenweberfamilie Fontana und die polnische Bauern- und Bergarbeiterfamilie Lukacs, die aus politischen, religiösen und wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland fliehen; die Ahnen seiner Eltern Friedrich und Maria Forte. Mit der Schilderung seiner Kindheit im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk hat der Schriftsteller seiner Heimatstadt ein großes literarisches Denkmal gesetzt. Als die nächtlichen Luftangriffen der Alliierten auf die Städte des Rhein-Ruhr-Gebietes zunahmen, wurde Maria Forte mit den beiden Söhnen Dieter und Wolfgang in den süddeutschen Raum evakuiert.
Im Herbst 1942 kamen sie nach Rohrbach. In seinem Roman schildert Forte in künstlerischer Freiheit auch seinen knapp einjährigen Aufenthalt im Anwesen der Bäcker- und Gastwirtsfamilie Heinrich Riedmann, dem Elternhaus des Verfassers dieses Artikels. Dass in dem Romanteil "Der Junge mit den blutigen Schuhen" (später "Tagundnachtgleiche") von 1995 Rohrbach erwähnt ist, erfuhr der Verfasser von einem Franken, den es nach Düsseldorf verschlagen hatte, und der den Schriftsteller gezielt nach den im Roman vorkommenden Dörfern und Städten befragt hatte.
Zahlreiche Einzelheiten beschrieben
Die Schilderung aus der Sicht eines siebenjährigen Jungen ist von einer negativen Grundstimmung und von Verbitterung geprägt. Forte berichtet mehr als 50 Jahre nach den Ereignissen sehr genau über zahlreiche Einzelheiten. Die Dorfschule behagte ihm nicht, er musste sich plötzlich auf die lateinische Schreibschrift umstellen. Meist befasste er sich mit seinen Büchern oder lag wegen seines Asthmaleidens im Bett. Zu den französischen Kriegsgefangenen im Ort hatte er ein gutes Verhältnis. Gerne hielt er sich in der leeren Gastwirtschaft auf und hörte dort Radio, an Backtagen holte ihn der Bäcker Franz in die Backstube.
Sein Bruder Wolfgang dagegen, 5 Jahre alt, hatte viele Freunde im Ort, fuhr mit den Bauern mit dem Ochsengespann auf die Felder hinaus, war lebenslustig und kostete den dörflichen Abenteuerspielplatz aus. Mit einem Mädchen aus dem Dorf steckte er sich im Juni 1943 mit einer offenen Lungentuberkulose an. Nach nur einer Woche im Luitpoldkrankenhaus Würzburg verstarb der ebenfalls asthmakranke Wolfgang Forte am 26. Juni 1943. Er wurde am Vormittag des 30. Juni 1943 auf dem Rohrbacher Friedhof beigesetzt. Das kranke Mädchen aus dem Dorf konnte die TBC nach 16 Wochen Krankenhausaufenthalt überwinden.
Abenteuerliche Flucht vor den Russen
Maria Forte verfiel in eine tiefe Depression. Kurze Zeit später zogen die Fortes nach Sonneberg in Thüringen. Ihre Situation verbesserte sich dort keineswegs. Maria wurde zur Arbeit in einer Munitionsfabrik zwangsverpflichtet, der Junge kam in ein Jugendlager. Erneut erlebten die Fortes in Sonneberg Tieffliegerangriffe und Bombardements. In einer abenteuerlichen Flucht verließen sie unter Verlust eines Großteils ihrer Habseligkeiten die Russische Zone und erreichten Heiligabend 1945 wieder Düsseldorf.
Im ersten Jahrbuch 2003 der Geschichtswerkstatt Karlstadt hat der Verfasser dieses Artikels die Schilderungen Fortes in seinem Roman betrachjtet und die Situation und Erfahrungen anderer Familien aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, die es nach Rohrbach verschlagen hat, dagegen gestellt. Hier haben alle das Ende des Zweiten Weltkrieges unversehrt erlebt. Vielfach wurden bis weit in die Nachkriegszeit Freundschaften gepflegt. Das von Forte im Roman vermittelte düstere Bild der Dorfgemeinschaft steht gegenüber den vielen guten Erfahrungen der Bombenkriegsflüchtlinge allein.
Dieter Forte, Das Haus auf meinen Schultern, Romantrilogie, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1999, ISBN 3-10-022117-6.
Josef Riedmann, Evakuiert aufs Land – Bombenkriegsflüchtlinge in Rohrbach, Jahrbuch 2003 der Stadt Karlstadt und seiner Stadtteile, Druck & Verlag Gerhard Kralik GmbH, Karlstadt.