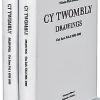Nicola Del Roscio: Cy Twombly, Drawings, Catalogue Raisonne Vol. 2 (Schirmer/Mosel, 308 Seiten, 267 Farbtafeln, 148 Euro). Dies ist Band zwei der auf fünf Folgen konzipiertebn Werkschau mit den Zeichnungen von Twombly (1928-2011). Er beinhaltet u. a. die berühmten „Sperlonga“-Zeichnungen sowie die Serie „Poems to the Sea“. Die Arbeitgen der Jahre 1956 bis 1960 spiegeln jene Phase, in der sich Cy Twombly nach mehreren Aufenthalten in Italien für einen dauerhaften Wohnsitz in Rom entscheidet und somit in Europa mit seinem reichen Fundus an klassischen kulturellen Themen Fuß fasst. Seine Zeichen werden besonnerer, gleuiten wie schwerlos über cremig geronnene Flächen. Jean-Christophe Grangé: Der Ursprung des Bösen (Lübbe, 860 Seiten, 19,99 Euro). Mathias Freire leidet unter einer rätselhaften Krankheit: Sobald er in Stress gerät, verliert er das Gedächtnis. Und wenn er das Bewusstsein wiedererlangt, ist er ein anderer: Ein neues Ich hat sich formiert, mit einer neuen Vergangenheit, einem neuen Lebensschicksal. Währenddessen sucht die Polizei nach dem Täter einer Serie von Ritualmorden, die allesamt in der Nähe Freires verübt wurden, ohne dass man diesem etwas nachweisen kann. Und wenn nun doch er der Mörder ist? Freire gerät zunehmend in Panik. Auf sein Gedächtnis ist kein Verlass. Also muss er einen anderen Weg finden, um seine Vergangenheit zu rekonstruieren. Doch die Suche nach seiner wahren Identität wird schon bald zu einem entsetzlichen Albtraum. Nikolai M. Prschewalski: Reisen in der Mongolei (Marix, 320 Seiten, 24 Euro). Prschewalskis Reiseberichte aus Zentral- und Ostasien sind auch heute noch bedeutungsvoll. Er gilt als einer der größten Asienreisenden der Neuzeit: In den Jahren 1870 bis 1873 legte er auf dem Weg zum Kuku-Nor, dem größten Gewässer Tibets, mit seinem kleinen, aber schwerbewaffneten Expeditionschor Tausende von Kilometern in den lebensfeindlichsten Gebieten der Erde zurück und sammelte Unmengen an geographisch, zoologisch, botanisch und ethnographisch richtungsweisendem Material über Zentralasien. Weniger ruhmvoll, aber ebenso interessant dürfte eine moderne Einschätzung seiner chauvinistischen Persönlichkeit ausfallen: Im Geiste mehr Eroberer als Forscher, ist Prschewalskis Bericht ein aufschlussreiches Dokument des kolonialistischen Sendungsbewusstseins im ausgehenden 19. Jahrhundert. Roberto Costantini: Du bist das Böse (C. Bertelsmann, 576 Seiten, 19,99 Euro). Dies ist der Auftakt einer international gefeierten Thriller-Trilogie. Während ganz Rom 1982 das Fußball-WM-Endspiel Italien gegen Deutschland verfolgt, wird eine junge Angestellte des Vatikan ermordet. Der draufgängerische Commissario Balistreri nimmt den Fall auf die leichte Schulter. Ein Mörder wird nie gefunden. Über zwanzig Jahre später gibt es erschreckend aktuelle Gründe, um den Fall wieder aufzunehmen. Doch dem Opfer nach so langer Zeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, kostet Balistreri einen weit höheren Preis als angenommen. Antti Tuomainen: Der Heiler (List, 224 Seiten, 14,99 Euro). Helsinki im Ausnahmezustand. Ein Irrer, der mordet und Heilsbotschaften verkündet. Eine Journalistin, die ihn stellen will. Und dabei spurlos verschwindet. Es gibt nur einen, der sie retten kann. Ihr Mann macht sich verzweifelt auf die Suche. Er würde alles für sie tun. Doch das Böse ist stärker als die Liebe. Das Buich wurde ausgezeichnet mit dem Vuoden Johtolanka 2011, dem angesehensten finnischen Medienpreis für Kriminalliteratur. Pedro Álvares Cabral: Die Entdeckung Brasiliens (Marix, 304 Seiten, 24 Euro). Die Südatlantik-Expedition von Cabral war eine logistische Meisterleistung. Drum scheint es aus der Sicht der heutigen Geschichtswissenschaft verwunderlich, die am 22. April 1500 gemachte Entdeckung der brasilianischen Küste einer Unterschätzung der Strömungsverhältnisse und damit dem Zufall zuschreiben zu müssen. Dennoch wurden Stimmen laut, die Cabral den Ruhm der „wahren“ Entdeckung Brasiliens absprechen wollen, und behaupten, dass das Land bereits damals, zumindest den Umrissen nach, kartiert gewesen sei. Eine finale Antwort wird wohl niemand geben können. Die akribische Quellenrekonstruktion bringt jedoch viel Licht ins Dunkel und macht den Leser mit einigen der frühesten und aufschlussreichsten Dokumenten der Entdeckungsgeschichte vertraut. Jane Johnson: Die Sklavin des Sultans (Page & Turner, 544 Seiten, 16,99 Euro). Marokko 1677: Hinter den prächtigen Mauern des Sultanspalastes von Meknes wird Nus Nus, der Sohn eines verfeindeten Stammesfürsten, als Sklave gehalten und fristet ein tristes Leben als niederer Schreiber. Eines Tages wird er in die brutalen Intrigen der mächtigsten Angehörigen des Hofes hineingezogen: dem grausamen und rücksichtslosen Sultan Mulai Ismail, seiner einflussreichen Hauptfrau Zidana, berüchtigt ob ihrer Vorliebe für Gift und schwarze Magie, und dem hinterhältigen Großwesir Abdelaziz. Zur selben Zeit wird die junge Engländerin Alys Swann von berberischen Piraten entführt und an den Hof von Meknes gebracht. Schon bald macht der Sultan sie zu seiner ersten Nebenfrau. In ihrem Kampf ums Überleben am Hof treffen Alys und Nus Nus aufeinander und gehen ein ungewöhnliches Bündnis ein – doch Zidana setzt alles daran, die gefährliche Nebenbuhlerin auszuschalten.
Kultur