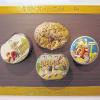Lange außer Mode oder in Vergessenheit geraten, scheinen Griffel und Tafel nun ihren Weg zurück an die Grundschulen zu finden. Viele Schulpädagogen sehen sie wieder als geeignete Mittel zur Erlernung des Schreibens an. Für das Schulmuseum in Sendelbach ist das ein Anlass zum Blick zurück.
Griffel und Tafel überzeugen durch größere Umweltfreundlichkeit, verbrauchen gerade die Grundschulen doch Massen von Papier für Übungs- und Arbeitsblätter. Die modernen Schüler haben es natürlich nicht mehr mit den leicht zerbrechlichen Schiefertafeln, sondern mit widerstandsfähigen Kunststofftafeln zu tun. Ein weiterer Punkt, sie für Erstklässler zu empfehlen.
Bemerkenswert ist, dass schon vor knapp 70 Jahren eine ähnliche Rückbesinnung auf die Vorteile der Schiefertafel stattfand. Damals zwang allerdings der Krieg zum Papiersparen. „Gestern gab noch Papier in Hülle und Fülle. Heute im Krieg ist es wieder ein bisschen anders geworden“, schrieb die Lohrer Zeitung im Jahre 1942.
Überzeugen Tafeln und Griffel durch ihre Einfachheit, so sollte man sich doch nicht täuschen lassen. Die Lehrer im 19. Jahrhundert machten aus der richtigen Beschaffenheit von Schiefertafel, Griffel und Hilfsinstrumenten nach dem Grundsatz „Gut' Werkzeug, halbe Arbeit“ eine wahre Wissenschaft.
Die Schiefertafel musste in Bezug auf Größe, Rahmen, Material und Liniatur optimiert werden. Dabei durfte sie nicht zu teuer werden und den damaligen Durchschnittspreis von 35 Pfennig überschreiten. Der Schiefer musste weich, glatt und nicht zu dünn sein. Damit sich das Geschriebene gut vom Hintergrund abhebe, sollte er von tiefer dunkelblauer Farbe sein.
Auf den Rahmen kommt es an
Als „Cardinalpunct“ wurde der Rahmen angesehen. Oft sei dieser zu schwach gewählt und führe zum Zerbrechen der Tafel. „Wer sich von der Nothwendigkeit einer zweckentsprechenderen Umrahmung des Schiefers überzeugen will, halte nur einmal Umschau in einer Classe: halb- und ganzzerbrochene, zersprungene, genietete, beblechte, belederte, geschindelte, geleimte oder auf andere Weise befestigte Rahmen werden deutlicher als Worte sprechen. Die schon erwähnten Blech- oder Holzbeschläge an den Ecken sind auch nicht von Dauer, zumal für den zerstörungslustigen Knaben.“ (Schulanzeiger 1877)
Für die oft erforderliche Reinigung einer Tafel sah man Wischer oder Schwämmchen vor, deren Gebrauch vom Lehrer anzuordnen war. Angewidert sprach der Schulanzeiger von der Unsitte, die Tafel „mit Speichel und dem Ballen der rechten Hand zu reinigen. In kurzer Zeit sind bei diesem Verfahren Steine und Rahmen mit einer fettigen Schmutzschicht überzogen, welche das Schreiben erschwert. Eine solche Wischoperation macht zudem einen äußerst widerlichen – ja ekelhaften Eindruck auf den Zuschauer.“
Aber auch das Schreiben auf die Schiefertafel selbst war eine Kunst für sich. Wurde der Griffel zu leicht geführt, war das Ergebnis kaum zu lesen. Bei zu starkem Druck bekam die Tafel bald tiefe Furchen und wurde mit der Zeit unbrauchbar, nicht zu vergessen die störenden Kratzgeräusche. Dass zudem der Griffel selbst noch sehr zerbrechlich war, machte die Schreibarbeit für die Schüler nicht leichter.
Zusammengefasst kann man sagen, dass im Fall der Wiedereinführung von Tafel und Griffel sowohl Schüler als auch Lehrer sich stark umgewöhnen müssen.