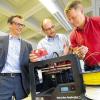Noch vor wenigen Monaten konnten sich die meisten Menschen unter dem Begriff „3D-Drucker“ kaum etwas vorstellen. Was druckt der? Noch vor wenigen Monaten sagten die, die sich auskannten: „Viel zu teuer, um mit einem 3D-Drucker in die Massenproduktion zu gehen.“ Das sieht Matthias Funken, Leiter des Rechenzentrums der Universität Würzburg ganz anders: „Das wirklich Neue ist, dass der 3D-Drucker auch für den Massenmarkt tauglich ist.“ Funken geht davon aus, dass in naher Zukunft in einem Großteil der Haushalte der 3D-Drucker neben dem konventionellen Drucker stehen wird: „Im Alltagsprozess wird der 3D-Drucker eine immer wichtigere Rolle spielen.“
Das liege unter anderem daran, dass 3D- Drucker immer günstiger werden. Heute bekomme man ein solches Gerät bereits für rund 800 Euro, je nach Konstruktion und Zweck. 800 Euro, das sei vom Preis für einen Tintenstrahldrucker „ja nicht mehr so weit weg“. Und das „Druck“-Material? „Kostet fast nichts“, sagt Funken. 35 Euro das Kilo, damit könne man sehr viel drucken, zumal die Geräte auf sparsamen Materialverbrauch ausgerichtet seien.
Was ist überhaupt ein 3D-Drucker?
Ein 3D-Drucker ist ein Präzisionsgerät, das dreidimensionale Werkstücke aufbaut. Dabei ist die Bezeichnung „Drucker“ irreführend, denn die Maschine druckt nicht, sie trägt auf: Schicht für Schicht. Dieses Auftragen – und das ist der Witz – geschieht computergesteuert.
Das Material besteht aus verschiedenen Kunststoffen, Kunstharzen oder auch Keramiken, die zum Auftragen verflüssigt werden müssen – und dabei beträchtliche Temperaturen entwickeln, weit über 200 Grad Celsius. Beim Auftragen und nach Fertigstellung des Objekts härten die Materialien dann wieder aus. Und warum werden die Objekte nicht konventionell, also mit einer Drehbank oder Fräse, hergestellt? „Jedes Fertigungsverfahren hat seine Daseinsberechtigung,“ sagt Funken. Eine Drehbank sei für rotationssymmetrische Objekte geeignet, eine Fräse für die Verarbeitung von Stahl – den könne der 3D-Drucker natürlich nicht verarbeiten.
Den Siegeszug des 3D-Druckers sieht der Leiter des Rechenzentrums darin begründet, dass man viele Objekte des Alltags damit fertigen könne. „Laufen Sie mal durch Ihre Wohnung und schauen, was aus einem Kunststoffteil hergestellt ist.“ Funken nennt Teile von Espressomaschinen, Küchengeräten oder den Deckel des Batteriefachs für die Fernbedienung des Fernsehers. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Woher bekommen Anwender ihre Vorlagen?
Bleibt die Frage: Wenn der 3D-Drucker computergesteuert arbeitet, woher bekommen Anwender dann ihre Vorlagen? Funken nennt drei verschiedene Wege, an die 3D-Vorlagen zu kommen.
Zum einen: Selbst konstruieren – wenn man weiß, wie‘ s geht. Die erste Hürde könne man aber mit geeigneter Software nehmen, neben vielen anderen zum Beispiel google-sketchup, mit der sich unkomplizierte 3D-Modelle relativ einfach konstruieren lassen. Kompliziertere Strukturen, das gibt Funken zu, seien für Laien noch etwas schwierig zu konstruieren.
Zum anderen kommt man an die Vorlagen durch eine riesige Community. Bleiben wir beim zerbrochenen Batteriefachdeckel für die Fernbedienung. Sie sind sicher nicht der Erste, dem das kleine Desaster widerfahren ist. Auf der Internetplattform thingiverse.com gibt man die Marke der Fernbedienung ein und findet mit großer Wahrscheinlichkeit ein fertiges 3D-Modell für den eigenen Batteriefachdeckel.
Mittlerweile stehen bei thingiverse Tausende Modelle zum kostenlosen Download bereit. Zwischenspeichern auf einer SD-Karte, ab damit in den 3D-Drucker, einschalten und los geht’s. Das Schwierigste bei dem Prozess ist vermutlich die halbe Stunde Wartezeit, die es zu überbrücken gilt, bis der neue Deckel ausgedruckt und abgekühlt ist. Wir erinnern uns: Temperaturen von mehr als 200 Grad entstehen beim Drucken. Die Datenmenge einer Konstruktionsanweisung sei nicht sehr groß, sagt Funken, einige Kilobyte. „Das ist nichts heutzutage“, und so lassen sich die Modelle auch leicht per E-Mail versenden.
Die dritte Möglichkeit: Man geht (in naher Zukunft) auf die Homepage der Firma, die die Fernbedienung herstellt und lädt sich dort das gesuchte Modell herunter.
Die Frage nach dem Urheberrecht
Moment mal. Und was ist mit Urheberrechten? Ja, das sei ein wichtiges Thema, meint Funken, „aber das war es im Internet schon immer.“ Der Leiter des Rechenzentrums nennt den MP3-Download in der Musiksparte oder den Videokanal YouTube als Beispiele. Den Download auf der eigenen Homepage anzubieten sei für eine Firma eine gute Möglichkeit, sich das eigene Stück vom Kuchen des wachsenden 3D-Markts zu sichern.
Vor einigen Monaten tauchten in den USA kostenlose Online-Modelle für den Druck einer Waffe im 3D-Verfahren auf. Die Pläne mussten auf Druck des US-Verteidigungsministeriums wegen des Verstoßes gegen Waffenexport-Vorschriften wieder entfernt werden. Dennoch: Missbrauch ist möglich. Das weiß auch Prof. Dr. Frank Steinicke vom Institut für Mensch-Computer-Medien an der Universität Würzburg. Steinicke sagt: „Keine Technologie ist von sich aus böse“, es komme immer darauf an, was man mit ihr anstelle.
Das Rechenzentrum der Uni Würzburg
Das Rechenzentrum der Uni Würzburg ist der zentrale IT-Dienstleister der Hochschule. Es stellt seine Dienste den Studierenden und Angehörigen der Universität zur Verfügung. Rund 60 Mitarbeiter sind am Rechenzentrum tätig. Rund 40 000 junge Menschen, darunter fast 30 000 Studierende, waren im Dezember 2012 als Benutzer registriert.
In seinen Anfängen war das Rechenzentrum dem Institut für Mathematik am Röntgenring angeschlossen. Da mit der Zeit immer mehr Rechnerleistung nötig wurde und viele Aufgaben rund um die Kommunikations- und Informationstechnologie hinzukamen, wurde das Rechenzentrum selbstständig.
Das Rechenzentrum hat vier Arbeitsbereiche: Systembetrieb, Netzwerke und Kommunikation, Beratung und Ausbildung, Multimedia-Dienste. Projekte und Publikationen: