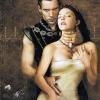Sogar Michelangelo huscht einmal durchs Bild, macht eine genervte Grimasse und gibt durch einen farbgesprenkelten Vorhang kurz den Blick frei auf ein halb fertiges Jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle. Er rennt dabei beinahe Papst Paul III. über den Haufen, doch der bleibt gelassen: „Ich lasse ihn gewähren, er ist ein Genie.“ Man muss sich nicht unbedingt für Kunstgeschichte oder auch nur Geschichte interessieren, um von der Serie „Die Tudors“ fasziniert zu sein. Aber ein wenig Sinn für die Ereignisse, die das heutige Europa auf den Weg gebracht haben, erhöht den Spaß erheblich.
„Die Tudors“ (2007–2010, ab 7. Dezember wieder auf Sat.1 Emotions) beschreibt in vier Staffeln Leben und Herrschaft des englischen Königs Heinrich VIII. (1491–1547), der natürlich vor allem für seine sechs Ehen bekannt ist. Tatsächlich sind diese Ehen – immerhin enden zwei mit einer Hinrichtung – nicht nur eine gruselige biografische Besonderheit, sondern sie sagen ein Menge aus über die Persönlichkeit des Königs und seine Zeit: Heinrichs obsessiven Jagdtrieb (wobei er sich als äußerst attraktiver König zumindest bei den Frauen nicht allzu sehr anstrengen muss), seine Neigung, sich sehr schnell zu ver-, aber auch sehr schnell wieder zu entlieben, und schließlich seine verzweifelte Hoffnung auf einen männlichen Thronfolger.
Einen solchen braucht er dringend. England steht nach den Rosenkriegen weiterhin am Rande des Bürgerkriegs, zumal der Herzog von Buckingham ältere Rechte auf die Krone geltend macht. Heinrichs gesamte Regierungszeit ist geprägt von der Machtfrage. Systematisch stellt er die alten Häuser kalt, brutal beseitigt er Kritiker, erbarmungslos zerschlägt er Widerstand in der Bevölkerung. Denn seine Abkehr von Rom, sein Anspruch, als oberster Kirchenherr Englands anerkannt zu werden, die Auflösung der Klöster, die Verstoßung seiner populären ersten Frau, Katharina von Aragon, seine Exkommunikation, das alles nur, damit er sich scheiden lassen und seine Mätresse Anne Boleyn heiraten kann – das kommt nicht sehr gut an. Weder bei hochgeschätzten Weggefährten wie dem Humanisten Thomas Morus noch draußen im Lande.
Die Anglikanische Kirche wird Heinrichs bedeutendste und dauerhafteste Schöpfung bleiben, für ihn selbst aber erweist sich, was wie eine mit allen Anzeichen des Größenwahns ausgelebte Laune aussieht, als böse persönliche Falle: Wer nicht mit allen Konsequenzen für ihn ist, der ist gegen ihn. Thomas Morus, den er liebt wie keinen Vertrauten sonst, weigert sich, den Eid auf den König als Kirchenoberhaupt zu schwören – Heinrich muss ihn hinrichten lassen, will er die eigene Autorität nicht irreparabel beschädigen.
Der Moment, in dem das Beil fällt und Heinrich in seinem dunklen Palast vor Schmerz und Einsamkeit aufheult, ist eine von vielen Szenen, in denen Geschichte lebendig wird. Die Ausstattung von „Die Tudors“ ist vor allem in den Kostümen überwältigend authentisch, auch wenn sich Autor Michael Hirst einige dramaturgische Freiheiten erlaubt. So werden historische Abläufe telegen gestaucht, Begegnungen erfunden: Hans Holbein etwa kann den sterbenden Heinrich 1547 nicht gemalt haben – er starb 1543. Und Kutschen, wie sie in der Serie dauernd benutzt werden, sind zu Heinrichs Zeit noch nicht in Gebrauch.
Die Figuren selbst aber wirken beängstigend echt. Jonathan Rhys Meyers ist ein atemberaubend junger, charismatischer Heinrich. Allein in seinen hellen Augen wird der ständige Kampf sichtbar zwischen brutalem Machthunger und Sehnsucht nach Zärtlichkeit, zwischen Neugier und Reizbarkeit, zwischen politischer Abwägung und persönlichem Draufgängertum, zwischen Rausch und Beherrschung. Diesem Mann traut man ohne weiteres zu, die Welt im Handstreich zu verändern – aus welchen Motiven auch immer.
Jonathan Rhys Meyers ähnelt tatsächlich einem frühen Porträt Heinrichs, noch frappierender aber ist die Ähnlichkeit zwischen Jeremy Northam und Thomas Morus – in der ersten Folge fährt die Kamera einmal am Hofstaat entlang, und da steht Morus, angetan mit der Kette des Lordkanzlers, als sei er direkt dem Porträt von Hans Holbein entstiegen, das heute in der Frick Collection in New York hängt. Ebendort, auf der anderen Seite des Kamins, hängt kurioserweise auch Morus' tödlicher Widersacher, ebenfalls gemalt von Holbein: Thomas Cromwell, der in Heinrichs Auftrag die englische Reformation durchpeitscht und später selbst – wie so viele andere – in Ungnade fällt. James Frain spielt ihn als beunruhigend skrupellosen Emporkömmling.
Und dann die Frauen: Natalie Dormer (derzeit in „Game of Thrones“ zu sehen) als berechnend verführerische Anne Boleyn, Maria Doyle Kennedy als integre und politisch gar nicht so arglose Katharina, Annabelle Wallis als wunderschöne und warmherzig kluge Jane Seymour und Joely Richardson als mutig intellektuelle Catherine Parr – sie alle sind zunächst Hoffnungsträgerinnen und werden schließlich doch zu Opfern von Heinrichs Unfähigkeit, echte Beziehungen aufzubauen. Als Heinrich schließlich stirbt, ist er vermutlich der einsamste Mensch in England. Eines seiner Ziele aber hat er erreicht: Sein Name wird – anders als der vieler anderer Monarchen – nicht so schnell vergessen werden.