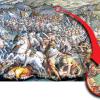Florenz, Venedig, Istanbul. Robert Langdon hetzt durch drei große Kulturstädte dieser Welt. Der Leser des neuen Dan-Brown-Romans ist ihm dicht auf den Fersen. Wie die meisten Geschichten des US-Bestseller-Autors ist „Inferno“ mehr als nur ein handwerklich sauber gemachter Thriller, der mit unerwarteten Wendungen überrascht. Quasi nebenbei befördert der ehemalige Englischlehrer spannende Details aus der Kunstgeschichte ans Licht der Öffentlichkeit.
Auf der Suche nach einem mutmaßlichen Bioterroristen stößt Hauptfigur Langdon auf die Buchstabenkombination „catrovacer“. Der Symbologie-Professor erkennt das als Anagramm von „cerca trova“. Im Italienischen bedeutet das in etwa „suche und du findest“. Dass es dabei um ein verschwundenes Gemälde von Leonardo da Vinci gehen könnte, wird nur beiläufig erwähnt. Die Romanhandlung läuft in eine andere Richtung. In der Wirklichkeit ist das aber eines der spannendsten Geheimnisse der Kunstgeschichte.
Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) malte ab Juni 1505 die „Schlacht bei Anghiari“ auf eine Wand des „Saales der Fünfhundert“ im Palazzo Vecchio zu Florenz. Im Zentrum des Freskos, das eine historische Schlacht von 1440 darstellt, kämpfen vier Männer auf sich wild gebärdenden Pferden. Das Bild gilt heute als verschwunden, es gibt aber noch Studien aus der Hand Leonardos. Im Pariser Louvre existiert zudem eine Kopie der zentralen Szene von Peter Paul Rubens (1577 bis 1640). Der Flame arbeitete zwar nicht nach dem Original, sondern nach einem Stich von 1553. Der aber entstand vermutlich direkt mit Blick auf Leonardos Werk. Das Fresko im Palazzo Vecchio sollte das größte Bild des Malers der „Mona Lisa“ werden. Leonardo hatte dafür ein spezielles Gerüst konstruiert. Das Gemälde wurde nicht vollendet. Der Meister hatte Probleme mit der Technik: Im oberen Teil des Bildes flossen Farben ineinander. Er gab das Projekt auf. Zwischen 1555 und 1572 wurde der „Saal der Fünfhundert“ unter Leitung von Giorgio Vasari (siehe Kasten unten) vergrößert. Im Zuge des Umbaus wurden die Wandmalereien vernichtet, einschließlich Leonardos „Schlacht bei Anghiari“.
Oder doch nicht? Architekt Vasari schuf selbst Bilder für den Saal, darunter die monumentale, acht mal 13 Meter große „Schlacht von Marciano“. Rechts oben malte er mitten in das Gewimmel der Soldaten ein grünes Banner. In weißen Buchstaben und vom Boden des großen Saales aus kaum zu sehen, schrieb er darauf das ominöse „cerca trova“. Ein Hinweis? Wenn ja: Was soll der, der sucht, denn finden können? Verbirgt sich etwas hinter dem Vasari-Bild? Vielleicht der Leonardo, den Vasari doch irgendwie erhalten konnte?
Vasari hat Leonardo da Vinci bewundert. Die „Schlacht von Anghiari“ pries er in höchsten Tönen, so unvollständig und schadhaft sie auch war: Er lobte die detaillierte Ausführung der Kleidung, die Meisterschaft in der Darstellung der Pferde. Hätte Vasari nicht versucht, solch ein Meisterwerk zu bewahren? „Cerca trova“ könnte eine Aufforderung an die Nachwelt sein, das Leonardo-Werk freizulegen. Aber warum hat Vasari den Hinweis derart verklausuliert? Warum hat er nicht offiziell dokumentiert, dass er das da-Vinci-Bild hinter seinem eigenen erhalten hat? Fragen über Fragen.
Es gibt Interpretationen des Spruches, die sich auf die historischen Gegebenheiten der Schlacht von Marciano, einer toskanischen Ortschaft, unweit von Arezzo berufen. Eine der Kriegsparteien habe grüne Banner mitgeführt, bestickt mit Sprüchen aus Dantes „Göttlicher Komödie“, heißt es. „Cerca trova“ sei lediglich eine Darstellung dieser Tatsache und habe nichts Mysteriöses an sich und mit Leonardo nichts zu tun.
Ende des Jahres 2011 rückte ein Team von Wissenschaftlern im „Saal der Fünfhundert“ an, um mit modernen Methoden Klarheit zu finden. Die Experten um den Kunsthistoriker Maurizio Seracini von der Universität San Diego bohrten sechs kleine Löcher in die Wand mit dem Vasari-Fresko. Sie stießen auf einen Hohlraum von ein bis drei Zentimetern. Mit Sonden und Geräten, wie sie sonst in der Chirurgie genutzt werden, blickten sie hinein, nahmen Proben. Sie entdeckten Indizien, die auf ein Leonardo-Werk hinweisen, etwa Farbpigmente, die in dieser Zusammensetzung ausschließlich von dem Renaissance-Genie verwendet wurden, wie das italienische Wissensmagazin „Focus“ berichtete. Viele Forscher glauben deswegen, dass Leonardos Schlachtengemälde noch existiert – wenigstens in Fragmenten –, dass Giorgio Vasari, um es zu bewahren, vor das Bild eine Wand einziehen ließ, sie bemalte und mit „cerca trova“ eine Spur legte.
Die Entdeckung machte vor gut einem Jahr Schlagzeilen. Endgültige Ergebnisse konnten die Wissenschaftler damals indes noch nicht vorlegen. Die scheint es bis heute nicht zu geben. Im Internet lässt sich nur der Hinweis finden, dass die Forschungsarbeiten seit Herbst vorigen Jahres ruhen. Auch, weil es Unstimmigkeiten wegen der Methoden des Seracini-Teams gab. Es bleibt spannend.
Giorgio Vasari und Florenz
Seine Schriften über Leben und Werk italienischer Künstler – darunter Leonardo da Vinci – machen Giorgio Vasari (Bild links) zu einem der ersten Kunsthistoriker. Vasari verwendete als Erster die Bezeichnung Gotik, die er allerdings abwertend gebrauchte: „Gotico“ bedeutet im Italienischen „wirr“. Auch die Begriffe Manierismus und Renaissance gehen auf ihn zurück.
Geboren 1511 in Arezzo, wurde Giorgio Vasari unter der Protektion der Medici zum Maler ausgebildet. Später arbeitete er als Architekt in Florenz. Er war einer der Baumeister der Uffizien, er gestaltete den Palazzo Vecchio um. Giorgio Vasari starb 1574 in Florenz.
Der Vasari-Korridor in Florenz wurde 1564 von Giorgio Vasari in nur fünf Monaten erbaut. Er verband den Palazzo Pitti, wo der Großherzog residierte, mit den Uffizien, wo der Regent arbeitete. Der Korridor (italienisch Corridoio) ist fast einen Kilometer lang. Er führt unter anderem in einem überdachten Gang über die berühmte Ponte Vecchio und durch das Innere der Kirche S. Felicita.
Der Corridoio ist – zu unregelmäßigen Öffnungszeiten – öffentlich zugänglich. Der Eingang befindet sich in den Uffizien zwischen Raum 25 und 34. Der Korridor ist heute eine riesige Galerie. Zu sehen sind dort über 1000 Gemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das Bild rechts zeigt einen Blick in den Korridor. In „Inferno“, dem aktuellen Roman von Dan Brown, spielen die Stadt Florenz mit ihren Bauwerken und Vasari-Werke eine wichtige Rolle. Text: hele