Musik ist möglicherweise die älteste Ausdrucksform des Menschen. Der Musikpsychologe Andreas C. Lehmann, Professor an der Würzburger Musikhochschule, erforscht ihre Wirkung auf uns in den verschiedenen Lebensaltern. Wie sich herausstellt, ist Musik nicht in jeder Lebensphase von gleicher Wichtigkeit. Wir entwickeln uns weiter, unsere Wahrnehmung und möglicherweise unser Geschmack tun es auch. Immer aber wohnt Musik die Macht inne, uns tiefer zu berühren als jede andere Kunst.
Frage: Meine erste bewusste Musikerinnerung ist „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ von den Beatles. Da war ich vielleicht vier. Ich liebe das Lied heute noch, mit 54. Was sagt das über mich aus?
Andreas Lehmann: Das sagt über Sie aus, dass Sie etwa so alt sind wie ich. Und darüber, welche Musik unsere frühe Jugend geprägt hat.
Das heißt also nicht, dass wir musikalisch in unserer persönlichen Entwicklung stehen geblieben sind?
Lehmann: Nein, nein. Das ist so etwas wie Ahoi-Brause – jedes Mal, wenn man die schmeckt, hat man so ein Gefühl von Kindheit. Ahoi-Brause schmeckt mir immer noch, ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich im Brausepulver-Stadium stehen geblieben bin.
Gute Analogie...
Lehmann: Es ist eine sogenannte episodische Erinnerung, die häufig stark mit Gefühlen verknüpft ist – Thema Weihnachtslieder, Summer Hits. Das geht alles in die gleiche Richtung. Wir haben eine starke Verbindung von biografischen Erinnerungen mit Musik. Im Fachjargon heißt das „Darling-they-are-playing-our-tune“-Effekt – sie spielen unser Lied.
Sie erforschen das Erleben von Musik in bestimmten Lebensphasen. Gibt es Muster, welche Musik den Menschen in welcher Phase wichtig ist?
Lehmann: Kinder können vor allem etwas mit textbasierter Musik anfangen. Also Lieder – Text plus Musik – oder „Peter und der Wolf“ und ähnliches. Weniger Beethovensche Sinfonik. Aber erst mal prägt die Musik, die zu Hause läuft, die Kinder – das können Shantys sein, Bachkantaten, Jazz der 50er oder das Hitradio. Aber wenn die Kinder in die Schule kommen, vor allem dann in die weiterführende Schule, dann begegnen sie anders sozialisierten Kindern. Sie entdecken eine Musik, die sie mit ihren Mitschülern, mit ihrer Peergroup teilen. Diese Musik wird dann ganz stark über die Grenzen von Schichten und Nationen hinweg die Identität dieser Jugendlichen formen.
Wenn ich also aus meiner familiären Blase herauskomme, ändert sich die Funktion, die Musik für mich hat. Und sie bringt mich vorwärts.
Lehmann: Ob vorwärts oder rückwärts, liegt im Auge des Betrachters. Viele Eltern werden eher sagen, Mensch, jetzt habe ich dir diese tolle Rock 'n' Roll-Musik oder die gute Heavy-Metal-Musik der 70er in die Wiege gelegt, und du drehst dich um und kommst mit diesem Rap und diesem Techno zurück. Aber im Prinzip haben Sie recht, man entwickelt sich weiter. Für manche Jugendliche, die intensiv ein klassisches Instrument lernen und im Pop nicht so richtig Bescheid wissen, kann das allerdings schwierig werden.
Wie ist das, wenn die Bedeutung der Peergroup, als der Gruppe Gleichaltriger, nachlässt – wenn ich berufstätig werde, eine Familie gründe?
Lehmann: Die Peergroup-Phase ist wahrscheinlich die, in der die Musik am wichtigsten überhaupt im Leben ist, weil sie sehr bewusst erlebt wird und zur Identität beiträgt. Nur mit diesem Wissen kann man verstehen, dass in der darauffolgenden Zeit andere Dinge wichtiger werden und Musik in den Hintergrund tritt.
Es ist also kein individuelles Phänomen, wenn Menschen in den mittleren Jahren sagen, Musik bedeute ihnen nicht mehr so viel wie früher.
Lehmann: Richtig. Ich würde sagen, dass die Identitätsfindung und die Suche nach der richtigen sozialen Gruppe und Beziehung stark mit Musik verknüpft sind. Mit Musik sind nämlich nicht nur musikalische Reize verbunden, sondern häufig auch eine Art zu denken, zu leben, sich zu kleiden. Sag mir, welche Musik du hörst, ich sage dir, wer du bist – diese Aussage trifft hier besonders zu. Später definiert man sich über ganz andere Dinge. Später wird der Chef nicht fragen, was hörst du denn so? Da spielen gemeinsame Werte eine Rolle. Hinzu kommt, dass man schlicht weniger Zeit hat. Man kann eben nicht mehr jedes Jahr nach Wacken fahren. Wenn die Kinder dann größer sind, kommt vielleicht der Moment, wo man sagt, so jetzt gehen wir wieder. Und dann mit den Kindern.
Warum sind eigentlich so viele Ärzte und Mathematiker gute Musiker?
Lehmann: Ich denke, Ärzte kommen häufig aus bürgerlichen Häusern, wo sie schon als Kind ein Instrument gelernt haben. Das wird für viele Akademiker gelten. Trotz der Möglichkeit für alle zu studieren, treffen sich an den Universitäten in bestimmten Fächern vor allem Leute aus der mittleren und oberen Schicht. Und die haben ein eher traditionelles Wertekonzept. Unsere Studierenden hier an der Hochschule kommen oft aus bürgerlichen Familien.
Das heißt, wir reden eher von Sozialisierung als von Begabung.
Lehmann: Richtig. Ich glaube nicht, dass Mediziner per se begabter wären als Elektroingenieure oder Elektriker. Nur kommen sie wahrscheinlich aus unterschiedlichen Familien. Es gibt kein Musikgen, wie man meinen könnte. Zum Thema Begabung und Leistungserwerb ist in den letzten 30 Jahren viel geforscht worden. Diese Forschung, die wir Expertiseforschung nennen, fragt, wie werden Leute gut, egal, auf welchem Gebiet. Es stellt sich heraus, dass die Mechanismen, die bei hochkarätigen Musikern wirken, auch bei hochkarätigen Sportlern wirken. Der Zirkusathlet durchläuft die gleichen Stadien wie der Pianist. Natürlich gibt es immer Elemente, die man nicht erklären kann, aber oft macht die Intensität der Beschäftigung den Unterschied. Anders gesagt: Effektiv genutzte Übezeit ist die beste Voraussetzung für Leistung. Nichts anderes.
Warum kann uns Musik überhaupt so tief berühren?
Lehmann: Diese Frage hat sich schon Darwin gestellt. Da muss man heutige Erkenntnisse aus der Evolutionspsychologie hinzuziehen. Da wir Musik heute als so bedeutend empfinden, muss sie schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte eine Bedeutung gehabt haben. Heute glaubt man, dass Musik die „Group Fitness“ erhöht hat: Die Spezies, die Musik machen konnte, hatte der anderen etwas voraus. Vermutlich ging es um grundlegende Effekte wie etwa die Stärkung des Gruppengefühls – gemeinsam singen, gemeinsam beschwören. Gemeinsam arbeiten, mit Hauruck einen Baum irgendwohin schleppen. Über große Entfernungen Botschaften zu singen – Jodeln etwa. Man muss wohl zwei Millionen Jahre zurückgehen, um erste Ursprünge zu finden. Die ersten Musikinstrumente finden wir erst vor 40 000 Jahren, aber dazwischen ist viel passiert. Lieder – die Verbindung von Text und Musik – erhöhen auch die Gedächtnisfähigkeit. In einer schriftlosen Kultur wie etwa der australischen hat man sich über gesungene „Songlines“ lange Wanderwege gemerkt oder große Geschichten und Sagen erzählt.
Musik als Sprache, die uns immer schon eigen ist.
Lehmann: Ja, da gibt es Grundformen, die auch in der Sprachmelodie zum Ausdruck kommen. Wenn ich Sie frage, „möchten Sie noch ein Glas Wasser?“, dann geht die Melodie nach oben. Das gibt es in allen Kulturen, nur kommen dazu unterschiedliche kulturelle Überformungen, so dass wir Musik anderer Kulturen nicht immer verstehen. Aber es gibt Ausdrucksformen, die immer verstanden werden.
Das heißt, ein Ureinwohner vom Amazonas kann auf jeden Fall Dur und Moll unterscheiden?
Lehmann: Dur und Moll sind schon wieder eine kulturelle Errungenschaft. Aber wenn Sie ein langsames Lied in einer tiefen Lage haben, dann wird das schon überall als traurig erkannt.
Liegt in der Nähe der Musik zu unseren Emotionen auch der Grund, warum sie im Alter wieder so wichtig werden kann?
Lehmann: Da gibt es einerseits ganz praktische Gründe. Sie können im Alter keinen Sport mehr treiben, aber Sie können immer noch in einem Chor singen. Und dann kommen wir irgendwann ans Ende des Lebens – heute weiß man, dass Musik etwa bei Alzheimer-Patienten oder bei Palliativ-Patienten die Möglichkeit eröffnet, noch Kontakt aufzunehmen. Vielleicht ist das das große Geheimnis der Musik: das Schamanische. Dass man auf fast mystische Weise wieder mit Menschen kommunizieren kann, deren kognitive Fähigkeiten fast ganz zusammengebrochen sind, die aber eben noch fühlen können und durch Musik in diesem Gefühl angesprochen werden können.
Weil Musik von allen Regungen am tiefsten in uns verankert ist?
Lehmann: Weil Musik uns sagt, da ist noch jemand anders. Musik hat immer dazu gedient, Beziehungen aufzubauen und zu stärken. Das beginnt schon mit der Mutter, die für das Kind singt. Und genau diese Mechanismen werden dann wieder angesprochen.
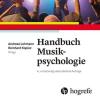
Person und Fachgebiet: Der Musikpsychologe Andreas C. Lehmann Andreas C. Lehmann studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und der Florida State University in Tallahassee, USA. 1992 promovierte er in Musikwissenschaft mit den Nebenfächern Musikpädagogik und Psychologie in Hannover. Von 1993-1998 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in Tallahassee, von 1998-1999 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität-Halle-Wittenberg. Lehmann ist seit 2000 Professor für Systematische Musikwissenschaft und Musikpsychologie an der Hochschule für Musik in Würzburg und deren Vizepräsident. Seine Forschungsergebnisse lassen sich auf musikalisches Lernen, Musikrezeption oder -produktion übertragen. Es geht dabei um Kognition, Emotion, Expertise, Üben, Begabung, Sozialisation, empirische Musikpädagogik und Aspekte zum Thema Musik und Gesellschaft. Lehmann publiziert in internationalen Fachzeitschriften, ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie und Beisitzer im Präsidium des Landesmusikrats NRW. Das Handbuch Musikpsychologie (Hogrefe, 800 Seiten, 49,95 Euro) gibt Andreas Lehmann gemeinsam mit Reinard Kopiez heraus. Im Herbst ist eine neue, überarbeitete Auflage erschienen. Das Buch befasst sich mit einer Fülle von Fragen, die auch für den musikalisch interessierten oder aktiven Laien spannend sind. Komplett neu ist ein Kapitel, das die musikalische Entwicklung nach Altersstufen behandelt. Es geht außerdem um musikalisches Lernen, Musik und Medien, Musikwahrnehmung, Musikleben von Komposition über Musikermedizin bis hin zur Musikerpersönlichkeit und schließlich die Frage nach der Wirkung von Musik auf den Menschen. maw
