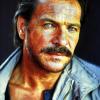Kürzlich hat Götz George wieder eine Kostprobe seiner Schnoddrigkeit geliefert. Als er in Berlin den Film „George“ über seinen Vater Heinrich vorstellte, ließ er sich zwar aufs Podium bitten, schmetterte vor dem gespannten Premierenpublikum aber jede Frage gnadenlos ab. Sie sei falsch gestellt, dazu könne er nichts sagen, und überhaupt sei er nicht der richtige Ansprechpartner. Rumms! Götz George darf das, vielleicht muss er es inzwischen sogar. Der Ausnahmeschauspieler, der an diesem Dienstag, 23. Juli, 75 Jahre alt wird, pflegt sein Image als Raubein – und die Liebe des Publikums ist ihm gewiss. Wer 48 Mal mit abgewetztem Parka als Ruhrpottkommissar Schimanski vor der Kamera stand, muss einfach ein abgefahrener Typ sein und möglichst oft „Scheiße“ sagen.
Mit dem Draufgänger aus Duisburg hat der gebürtige Berliner George Fernsehgeschichte geschrieben. Gegen die distinguierten Herren, die bis dato auf der Mattscheibe ermittelten, verkörperte er 1981 erstmals den genauso coolen wie prolligen Cop, der mit lockeren Sprüchen, harten Prügeleien und reichlich Bier auf Verbrecherjagd geht. „Was quatschst du mich so blöd an, du Spießer, nur weil ich 'ne Fahne habe?“, raunzt er sein Gegenüber einmal an. 29 „Schimmi“-Folgen liefen zwischen 1981 und 1991 im Rahmen der ARD-Krimireihe „Tatort“. 1997 widmete das Erste seinem Helden eine eigene Reihe: „Schimanski“. In diesem Jahr soll die 17. Folge laufen.
Die Liebe zum Theater
„George“, der Film über seinen legendären, wegen seiner Karriere in der Nazizeit auch umstrittenen Schauspieler-Vater Heinrich George (1893-1946), macht deutlich, wie sehr der Sohn zeitlebens von dem „Übervater“ geprägt war – und getrieben (siehe Kasten). „Du hast mich halt immer überholt. Du warst halt immer besser, besessener“, sagt George in der ARD-Dokumentation an die Adresse seines toten Papas. Götz ist acht, als sein Vater 1946 mit 52 Jahren im Lager Sachsenhausen in sowjetischer Gefangenschaft stirbt. Für ihn und seinen älteren Bruder Jan wird die Mutter, Berta Drews, zur Bezugsperson. Selbst Schauspielerin, weckt sie auch in ihrem „Putzi“, wie sie den Sohn bis an ihr Lebensende nennt, die Liebe zum Theater. Mit elf steht Götz George erstmals auf der Bühne, mit 15 hat er neben Romy Schneider seinen ersten Filmauftritt – in der Romanze „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“.
40 Hauptrollen auf der Bühne und 120 Kino- und Fernsehfilme folgen. Seine physische und psychische Präsenz, seine Wandlungsfähigkeit und sein Rollenverständnis tragen ihm immer wieder gute Kritiken ein. „Ich muss die Figuren inhalieren, anders kann man es gar nicht sagen, ich inhaliere sie, ohne intellektuell darüber nachzudenken“, verriet er. Er hat sie alle verkörpert: die edlen Helden, die traurigen Ritter, die Narren, die Monster und die Menschen aus Fleisch und Blut.
Im Film der 50er Jahre ist Götz George ein unbekümmerter Bursche, in den 60er Jahren der Heißsporn, der tollkühn in Winnetou-Filmen agiert. Aber auch schon damals kann er feinnerviger sein. Wolfgang Staudte besetzt ihn 1960 in dem Film „Kirmes“, in dem er einen Deserteur spielt. Als die Jungfilmer 1962 verkünden, dass „Papas Kino“ tot sei, beerdigen sie einen Star wie Götz George gleich mit. Zu professionell, zu viel Held, zu viel Männlichkeit – unzeitgemäß. Und für George sind die Jungen, die meistens älter sind als er, Dilettanten, die erst mal das Handwerk lernen müssen.
In den 70er Jahren sieht man ihn verstärkt im Fernsehen, häufig in Nebenrollen, wo er vom Rand aus immer wieder alle an die Wand spielt. Man ahnt: Der Typ ist noch lange nicht satt. Dass er eine beängstigende Fühllosigkeit spielen kann, zeigt er in „Aus einem deutschen Leben“ (1977): Den KZ-Kommandanten Rudolf Höß arbeitet er als emotionslosen Funktionsmenschen heraus. Als sie einen Nachfolger für den altersmüden „Tatort“-Kommissar Haferkamp (Hansjörg Felmy) suchen, erinnern sie sich an den sensiblen Kraftkerl mit Gemüt – George.
Horst Schimanski ist gefunden, und er prägt ein Jahrzehnt das deutsche Fernsehen. Der Melancholie der 70er Jahre gibt dieser proletarische Ermittler eins auf die Schnauze. Es kann cool sein, Fernsehen zu schauen, wenn Schimmi Bier schlürft, schöne Frauen an die breite Brust zieht und den Alltag zum Abenteuer veredelt. Sein legendäres „Scheiße!“ richtet sich gegen die erstarrte Welt der Biedermänner-Väter. Nach der Wiedervereinigung gelingen George bemerkenswerte TV-Rollen. Aber es sind die großen Rollen in „Schtonk“ (1992), „Der Totmacher“ (1995) und „Rossini“ (1997), die alles überstrahlen.
Zu den Medien hat George ein gespanntes Verhältnis; dem Fernsehen wirft er vor, „nur noch auf Kohle und Quote“ zu schauen. In Deutschland sei er nur mehr zum Arbeiten und Steuern zahlen, wie er sagt. Ansonsten zieht er sich mit seiner gut 20 Jahre jüngeren Lebensgefährtin nach Sardinien zurück. Schlagzeilen machten ein schwerer Badeunfall 1996 und eine Herzoperation 2007. In einem Gespräch zog George schon eine positive Lebensbilanz. „Ich bin immer einen recht gradlinigen Weg gegangen. Damit habe ich sicher immer wieder Menschen vor den Kopf gestoßen, aber ich habe mich nicht verbiegen lassen.“ Text: dpa, EPD, tbr
Doppeltes Ständchen der ARD
Die ARD bringt Götz George zu seinem 75. Geburtstag ein doppeltes Ständchen: Am Mittwoch (24. Juli, 20.15 Uhr) läuft im Ersten zunächst der Krimi „Schuld und Sühne“, der 2011 schon einmal in der Reihe „Schimanski“ zu sehen war. Anschließend (21.45 Uhr) folgt das neue Dokudrama „George“, in dem der Jubilar seinen berühmten, aber auch umstrittenen Vater Heinrich George (im Bild links) spielt. George hatte die ARD mehrfach wegen des Sendetermins kritisiert: Der Film laufe in der zuschauerarmen Ferienzeit und nicht zum 120. Geburtstag seines Vaters im Oktober. ARD-Programmdirektor Volker Herres wies die Kritik zurück: Mit dem Abend erweise das Erste dem großen deutschen Charakterdarsteller und Publikumsliebling eine besondere Ehre. Der Film von Joachim A. Lang geht vor allem der Frage nach, wie sehr sich der Jahrhundertschauspieler Heinrich George von den Nazis instrumentalisieren ließ. Darsteller sind neben Götz George Muriel Baumeister, Martin Wuttke, Samuel Finzi und Burghart Klaußner. Für die Produktion zeichnen Nico Hofmann und Jochen Laube von Teamworx in Zusammenarbeit mit SWR, WDR, RBB, NDR und Arte verantwortlich. Weitere Infos in einem Special im Internet: www.DasErste.de/George Buchtipps: Joachim A. Lang: Heinrich George: Eine Spurensuche (Henschel Verlag, 272 Seiten, 24,95 Euro) Berta Drews: Mein Mann Heinrich George (Langen Müller Verlag, 288 Seiten, 19,99 Euro) Text & Foto: dpa