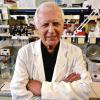Seit 2004 forscht Schwarz als Chefarzt des Zentrallabors des Würzburger Juliusspitals selbst intensiv am Impfstoff, für den zur Hausen die Grundlage schaffte. Revolutionär war die Idee, dass Viren bestimmte Krebsarten verursachen, die der Heidelberger Forscher 1978 zum ersten Mal in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichte. „Es war der Anstoß für die gesamte Forschung“, sagt Schwarz. Als zur Hausen schließlich die Papillomviren fand, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können, ging es rasant weiter. Inzwischen gibt es den Impfstoff, den die Ständige Impfkommission in Deutschland inzwischen zwölf- bis 17-jährigen Mädchen empfiehlt.
Wenn der Heidelberger Professor am 10. Dezember in Stockholm den Medizinnobelpreis bekommt, freut sich nicht nur Schwarz. Auch der Würzburger Professor Eberhard Wecker ist dann sicherlich in Gedanken dabei. Er war derjenige, der zur Hausen einst aus den USA zurück nach Deutschland holte, informiert Uni-Sprecher Robert Emmerich. Von 1969 bis 1972 blieb zur Hausen in Würzburg.
„Die wichtigste präventive Maßnahme in der Medizin in den letzten 20 Jahren“, sagt Schwarz über die Impfung. Die Würzburger Studie untersucht Verträglichkeit und Wirksamkeit des Mittels. Etwa 450 junge Frauen zwischen 15 und 26 Jahren beteiligten sich bisher daran in zwei Gruppen. Die Ergebnisse überzeugen Schwarz. Die Gruppe, die eine echte Impfung bekommt, sei hundertprozentig gegen den Krebs geschützt. Bei der Gruppe, die einen unwirksamen Stoff (Placebo) erhält, nehmen die Erkrankungsfälle zu. Wobei die Forscher keinen Krebs abwarten, sondern nur bis zur Vorstufe gehen.
Angst vor einem Impfstoff, zu dem es noch keine Langzeituntersuchungen gibt, haben die Frauen offenbar nicht. „Die Probandinnen haben uns die Türen eingerannt“, sagt Schwarz. Diejenigen, die Impfungen grundsätzlich positiv gegenüberstehen, nutzten die Möglichkeit, an einen neuen Stoff möglichst früh zu kommen, glaubt er.
Alle Fragen könnten ohnehin nie ausgeräumt werden. Die gegenwärtigen Studien seien auf zehn Jahre angelegt. Die Furcht vor Nebenwirkungen findet Schwarz unbegründet. Bei bisherigen Untersuchungen habe es keine Häufung von Auffälligkeiten gegeben. Hoffnung für Tausende Frauen allein in Deutschland bringe dafür die Impfung. Bei den 15- bis 44-Jährigen ist Gebärmutterhalskrebs der zweithäufigste Tumor. 7500 Erkrankungen und 2500 Todesfälle gibt es im Jahr. Bei 150 000 Frauen wird eine Vorstufe des Tumors operiert.
Über die Anerkennung der Forschung durch den Nobelpreis kann sich nun mit dem Heidelberger Professor eine große Gruppe Wissenschaftler freuen. Viele kleine Schritte waren nötig von der Entdeckung des Virus bis zum Impfstoff, sagt Schwarz. Den Erreger kann man nicht züchten. Die Arbeit mit reinem Genmaterial ist erst seit knapp 20 Jahren möglich. Für die Entwicklung des Impfstoffs war eine weitere wichtige Entdeckung nötig. So stellte eine australische Gruppe Anfang der 1990er Jahre erstmals leere Virusteilchen her.
Und die Würzburger Wissenschaftler freuen sich besonders, denn zur Hausen ist der 14. Nobelpreisträger, der einst an der Julius-Maximilians-Universität arbeitete.