Die 17-jährige Gymnasiastin Camilla Wagner aus Osterhofen in Niederbayern hat im Rahmen ihrer Seminararbeit „Geschichtliche Erinnerungsorte in Bayern“ den „Guten Ort“ am Ebnether Berg ausgewählt. Wieso interessiert sich eine Schülerin des Sankt-Gotthard-Gymnasiums in Niederalteich für den Judenfriedhof im fernen Oberfranken? Das Rätsel ist bald gelöst. Die Großeltern von Camilla wohnen in Ebneth.
Die Wagners sind für viele die „Musikfamilie“. Sohn Karsten ist nach dem Gitarrenstudium vor 25 Jahren aus familiären Gründen nach Niederbayern gezogen. Seiner Tochter hat er bei den Besuchen der Eltern mehrmals den Judenfriedhof gezeigt. Als Bub hatte er, besonders im Herbst, fast täglich den ruhigen Ort aufgesucht: „weil es dort einen recht zuverlässigen und ergiebigen Rotkappenplatz gab.“ Später gab er mit Herrn Pfreundner einige Konzerte mit jiddischen Liedern und besuchte beim jüdischen Neujahrsfest im September die Veranstaltung im Judenfriedhof.
Bei den Großeltern Judenfriedhof kennengelernt
Tochter Camilla blieb dieser Ort in Erinnerung: „Ich wollte meine Seminararbeit nicht über ein allzu populäres und breitgetretenes Thema schreiben. Ziemlich schnell fiel die Wahl auf den Friedhof, den ich von unseren Besuchen bei meinen Großeltern her sehr gut kenne.“ Sie schrieb die Redaktion des Obermain-Tagblattes an und bekam hilfreiche Informationen und Kontakte. Sie griff auf Zeitungsartikel und vor allem auf das Buch: „Guter Ort über dem Maintal“ von Josef Motschmann und Siegfried Rudolph als Informationsquelle zurück.
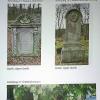
Bei der Durchsicht der von der Schule mit „sehr gut“ bewerteten Seminararbeit fällt zunächst das gut gegliederte und umfangreiche Inhaltsverzeichnis auf. Oft wird bei solchen Arbeiten das Vorwort übersehen. Doch dieses ist als Einstieg besonders interessant. Die Gymnasiastin geht auf die aktuelle Politik ein und prangert den bekannten „Vogelschiss“-Vergleich vom ehemaliger Partei- und Fraktionschef der AfD Alexander Gauland an. Sie führt die Vermehrung der antisemitistischen Anschauungen in den letzten Jahren auf: „Damit sich dieser spezifische Hass gegen eine einzelne Bevölkerungsgruppe nicht noch weiter ausbreitet, benötigt es unter anderem eine ausgiebige Auseinandersetzung mit rassistischen und antisemitischen Themen der Vergangenheit und der Gegenwart.“ Diesem ist zuzustimmen. Wir können froh sein, dass sich nach dem Projekt mit den jüdischen Führerscheinen am Gymnasium Lichtenfels eine weitere Gymnasiastin mit einem jüdischen Thema am Obermain auseinandersetzt.
Der Judenfriedhof ist der größte in Oberfranken
Beginnend mit einem Überblick über die Geschichte des deutschen Judentums und über das Judentum am Obermain kommt die Schülerin zum Schwerpunkt des Themas der Seminararbeit. Zunächst wird die geographische Lage des Judenfriedhofs im Ebnether Wald dargestellt. Danach zeigt sie die Bedeutung für die Judengemeinden in der Umgebung auf.

Vielen nicht bekannt: Zu Beginn der Niederlassung der Juden in Burgkunstadt wurden die jüdischen Bürger rund um die Kirche bestattet. Da dieser Platz nicht mehr reichte, kauften die Juden von der Stadt einen Platz am Hutanger und verlegten ihre Beerdigungen an diesen Fleck. Der Hutanger war einst eine Weide; eine Bebauung war aufgrund der schrägen Lage nicht möglich. Dieser Judenfriedhof zählt mit seinen über 2 000 Grabsteinen zu den größten jüdischen Landfriedhöfen Bayerns, er ist der größte in Oberfranken. In seiner 400-jährigen Geschichte durchlief er drei verschiedene Belegungsphasen.
Denkmal der verunglückten Jungfrau Sara Lobensteiner
Camilla Wagner geht genauer auf die Gestaltung der Grabsteine mit den Symbolen und Stammeszeichen an den Steinen ein. Ab den 1820ern findet man eine zweiseitige Beschriftung: auf der Seite des Toten in Hebräisch, auf der anderen in Deutsch. Veränderungen gab es im weiteren Verlauf der Jahrhunderte bei den Texten. Sie wurden immer länger. Neben den traditionellen Informationen wie „Name, Todestag und Ehrentitel wurden nun auch die Taten der Verstorbenen, teilweise sogar die Charaktereigenschaften bekannt gegeben. Als Beispiel nannte sie Sara Lobensteiner. Auf dem Grabstein steht die Inschrift: „Denkmal der, in finsterer Nacht, am 1. Nov. im Mainflusse verunglückten Jungfrau Sara Lobensteiner.“ Leider sind an vielen Grabsteinen die Inschriften nicht mehr lesbar.
In der NS-Zeit sollte der Judenfriedhof verkauft werden
Die 17-Jährige geht auch auf ein weiteres Detail im 20. Jahrhundert ein, welches vielen Lesern am Obermain nicht bekannt ist: Die Nationalsozialisten forderten, während sie an der Macht waren, die Städte und Gemeinden dazu auf, ihnen die jüdischen Einrichtungen zu verkaufen. Trotz vieler Schwierigkeiten hat es die Stadt Burgkunstadt geschafft, die drei jüdischen Gebäude sowie den Judenfriedhof nicht in die Hände der Nationalsozialisten fallen zu lassen; sie kaufte die Plätze selbst.
Die vier Grundstücke kosteten 1000 Reichsmark, später wurden weitere 200 eingefordert, da die Grabsteine am Friedhof mitgekauft worden waren. Es kursierten Gerüchte, die SA wolle auf dem Friedhof einen Schießplatz errichten. Einzelne Bürger schrieben Beschwerdebriefe an die Stadt, die bekannt gab, dass wegen des städtischen Erwerbs des Friedhofes kein Platz für Schießübungen auf dem heiligen Grund eingerichtet werden dürfe.
Interview mit Udo Bornschlegel-Diroll
Die Schülerin führte im Rahmen ihrer Seminararbeit auch ein ausführliches Interview mit Udo Bornschlegel-Diroll durch. Sie stellte dabei auch die Frage, was das Haus am Eingang des Friedhofs sei. Der Burgkunstadter erklärt darauf hin das sogenannte Tahara-Haus für die kultische Reinigung. Ebenso wurde im Fragenkatalog nach der Grabpflege und die Bedeutung der kleinen Steine auf Grabsteinen gefragt.
In ihrem Schlusswort der 30-seitigen Arbeit stellt Camilla Wagner fest: „Der jüdische Friedhof in Burgkunstadt ist kunsthistorisch gesehen eine der wohl interessantesten Gedenkstätten Bayerns, die nicht nur Aufschluss über jüdische Rituale und das gewaltsame Ende der jüdischen Gemeinde am Obermain gibt, sondern auch Einblicke in das Leben der jüdischen Bürger dieser Stadt bietet.“
Camilla wird voraussichtlich im Juni dieses Jahres ihr Abitur ablegen. Auf die Frage, wie ihre berufliche Zukunft aussieht, antwortet sie: „Ich spiele seit zehn Jahren Cello und habe vor, nach meinem Abitur Cello zu studieren. Sollte das nicht funktionieren, werde ich wahrscheinlich Journalismus, Geschichte oder Englisch studieren.“
