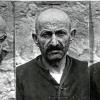Am Donnerstag, 30. Oktober, eröffnet im Rats- und Kultursaal in Knetzgau die Wanderausstellung „Mitten unter uns – Landjuden in Unterfranken vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert“. Aus diesem Anlass hat Cordula Kappner aus Haßfurt, die seit Jahren die Geschichte und das Schicksal von Juden im Haßbergkreis erforscht und aufarbeitet, einen Artikel verfasst, in dem sie speziell auf die jüdische Familie Schwarz aus Westheim eingeht. Sie bezieht sich darin auch auf den Vortrag „Erinnerungen an Westheim zur Zeit meiner Kindheit und meine Bemühungen um Synagogen“, den Professor Meir Schwarz aus Jerusalem im Februar 1997 in der ehemaligen Schule in Westheim gehalten hat:
„Meir Schwarz wurde in Nürnberg geboren und kam in seiner Kindheit häufig nach Westheim, um seinen Onkel Jakob Schwarz und dessen Familie zu besuchen. Jakob und Selma Schwarz lebten mit ihrer 1924 geborenen Tochter Martha im Haus Nummer 73, heute Eschenauer Straße 1. Eine zweite Schwangerschaft von Selma Schwarz endete mit der Totgeburt einer Tochter im Mai 1931.
Jakob Schwarz hatte aus Eggenhausen im Schwäbischen im Jahr 1922 in die Familie Pulver eingeheiratet, die zu einer der alteingesessenen jüdischen Familien in Westheim im damaligen Landkreis Haßfurt gehörte. Der Großvater von Selma Schwarz, Falk Pulver, starb im Alter von 83 Jahren im Jahr 1873 in Westheim im Haus Nummer 65, heute Eschenauer Straße 18. Die Großmutter wurde 1810 in Lülsfeld geboren. Die Urgroßeltern hießen Isaac und Sara Pulver.

Jakob Schwarz war Landwirt und Bäcker. Er war ein gutherziger Mensch, der manchem Bauern die 8 Pfennig Brückenzoll gab, wenn er nach Haßfurt fahren wollte, aber das Geld dazu nicht hatte. Im Winter backte er in Frankfurt am Main Mazzen, im Sommer war er in Westheim. Der 1881 geborene Jakob Schwarz war als 14-Jähriger nach Amerika gegangen und 1904 nach Deutschland zurückgekehrt. Im Ersten Weltkrieg war er Soldat. Nach seiner Heirat übernahm er das landwirtschaftliche Anwesen seiner Schwiegereltern.
Die niederdrückenden Umstände seines Lebens nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten waren für ihn, der herzkrank war und an epileptischen Anfällen litt, wohl besonders schwer zu ertragen. Beschimpfungen und ähnlicher Häme, die ihm als Juden zugefügt wurden, ist es vermutlich zuzuschreiben, dass er manchmal scheinbar gewalttätig auf Spötteleien der Kinder reagierte.
Ein Vorgang aus dem Oktober 1938 ist in der Gestapo-Akte von Jakob Schwarz im Staatsarchiv Würzburg festgehalten. Im Novemberpogrom wurde er, wie die anderen jüdischen Männer aus Westheim, verhaftet. Gegen 14 Uhr kamen am 10. November 1938 Männer aus Haßfurt auf einem Wagen angefahren und fingen die Juden ein, so erzählt ein Augenzeuge. Wer erwischt wurde, wurde geschlagen. Auch Kinder, die ungefähr 13 oder 14 Jahre alt waren, haben auf die Juden eingeprügelt.

Die jüdischen Männer wurden nach Haßfurt gebracht, ins dortige Gefängnis. Der Wagen, der sie nach Haßfurt fuhr, war ein kleiner Viehtransporter, in dem noch der Mist vom Vortrag lag. Jeder erhielt vor dem Einsteigen einen Schlag mit einem Prügel auf den Rücken. Nach Aufenthalten im Haßfurter und Hofheimer Gefängnis folgte die Haft im Konzentrationslager (KZ) Dachau.
Aus der Gestapo-Akte: „Mit Blitz-FS München Nr. 47767 v. 10.11.38 hat der Chef der Sicherheitspolizei - SS-Gruppenführer Heydrich die Einlieferung des Juden Jakob Schwarz (...) in das dortige KZ angeordnet. Er ist gesund, arbeits- und lagerfähig.“
Die Tochter Martha hatte ebenfalls unter den Anfeindungen Gleichaltriger zu leiden. Sie wurde mehrfach von einem gleichaltrigen Mädchen verprügelt, und während des Novemberpogroms am 10. November 1938 peinigte sie ein Jugendlicher, indem er ihren Kopf wieder und wieder ins Wasser tauchte. Vielleicht war es auch dieser Jugendliche, der ihr das größte Unrecht zufügte, mit dem sie dann in den Tod ging.
Nach seiner Entlassung aus dem KZ Dachau kehrte Jakob Schwarz nach Westheim zurück. Trotz einer Bürgschaft von Verwandten in den USA gelang Familie Schwarz nicht mehr die Flucht aus Nazi-Deutschland. Am 31. März 1942 schrieb Martha Schwarz einen Abschiedsbrief an ihren Cousin Meir. Aus dem Brief geht hervor, dass sie nicht ahnte, welches Schicksal sie erwartete.
Am Mittwoch, 22. April 1942, musste Familie Schwarz Westheim verlassen. Als an diesem Tag die jüdischen Bürger abtransportiert werden sollten, und alle schon auf dem Wagen zum Haßfurter Bahnhof saßen, fehlte Martha Schwarz. Sie hatte sich in ihrem Elternhaus versteckt. Zwei Brüder jagten sie daraufhin durchs Haus, nachdem einer von ihnen mit einem Besen das Fenster des verschlossenen Hauses eingeschlagen hatte. Mit einer Mistgabel wurde die 18-Jährige durchs Haus gejagt, berichteten Augenzeugen.
Nachdem alle Juden den Ort verlassen hatten, wurden – am helllichten Tag – ihre Häuser geplündert. Die Betten wurden aufgeschlitzt, das Inventar auf die Straße geworfen und später versteigert, besonders viel bei Ella Mahler.
Eine Einwohnerin erinnert sich später noch genau, wie die Juden ,weggekommen‘ sind: „Nie werde ich das vergessen. Es war morgens, ich war auf dem Weg zur Schule, als ein Leiterwagen mit zwei Gäulen durchs Dorf fuhr. Auf ihm saßen viele alte jüdische Leute, auch der alte Josef Pulver und seine Frau. Sie winkten mir zu. Zu meinem Vater sagten sie: ,Pass auf mein Haus auf, wir kommen wieder.‘ Alle weinten, ich auch. Wir hatten uns ja gegenseitig gern gehabt.“
Am Samstag, 25. April 1942, fuhr der Deportationszug vom Güterbahnhof Aumühle bei Würzburg um 15.20 Uhr in Richtung Osten ab. Noch einmal fuhren Jakob, Selma und Martha Schwarz durch Haßfurt. Der Transport umfasste 854 jüdischen Bürger – Männer, Frauen und Kinder unter 67 Jahren.

Am 28. April um 8.45 Uhr kam der Zug im Bahnhof von Krasnystaw bei Lublin an. Der Transportleiter des „Aussiedlungstransports“ meldete am 27. April an die Gestapo in Würzburg: „Transport vollzählig angekommen. Zwischenfälle keine.“ Für ihn wurde eine Beförderung veranlasst.
Der Zug fuhr weiter in das Übergangsghetto Izbica. In Lublin waren zwischen 2.30 und 5 Uhr die Wagen mit dem Gepäck abgehängt und die jungen Männer ab 16 Jahren zur Arbeit im nahegelegenen Vernichtungslager Maidanek selektiert worden. Die Menschen besaßen nichts mehr. Ihre deutsche Staatsangehörigkeit hatten sie mit dem Überschreiten der polnischen Grenze verloren.
Die Spur der deportierten Menschen verliert sich im Zwischenlager Izbica und in den Gaskammern der nahegelegenen Vernichtungslager Belzec und Sobibor, unter ihnen die Spur von Familie Schwarz aus Westheim. Von dem Transport hat niemand überlebt.
Die polnischen Juden, die nach dem Krieg für kurze Zeit, bis um 1948/49, in Westheim lebten, bewohnten das Haus von Familie Sündermann und holten ihr Wasser im Haus von Familie Schwarz. Es waren Displaced Persons – Überlebende aus den Lagern auf dem Weg in eine neue Zukunft.
Meir Schwarz gelang nach dem Novemberpogrom die Flucht aus Nazi-Deutschland. Er emigrierte nach Palästina, wo er sich mühsam durchschlagen musste. Er studierte und promovierte und hatte Professuren an mehreren Universitäten. Sein Weg führte ihn oft nach Deutschland. Das mehrbändige Werk „Mehr als Steine . . . Synagogen-Gedenkband Bayern“ verdankt ihm seine Entstehung und den Namen. Er lebt in der Altstadt von Jerusalem.
Ausstellung über Landjudentum
Die Wanderausstellung, die im Rats- und Kultursaal zu sehen ist, und zu der der Förderverein Gotteshütte Knetzgau einlädt, ist nach der Eröffnung am Freitag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr etwa drei Wochen zu sehen. Zur Eröffnungsveranstaltung kommt auch Haßfurts Stadtarchivar Thomas Schindler. Am Sonntag, 1. November, ist von 13 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür mit Kaffeestube, die am Sonntag, 15. November, ab 13 Uhr wiederholt wird. Am 15. November schließt sich von 17 bis 19 Uhr ein Konzert mit Klezmeron aus Nürnberg an. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Knetzgauer Rathauses zu besichtigen. Führungen können vereinbart werden unter Tel. (0 95 27) 95 08 32 oder 95 01 60.