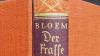Die Stadt Rieneck bewahrt ihren Dichtern Walter Bloem, Anton und Friedrich Schnack ein ehrendes Andenken, wie einem offiziellen Faltblatt zu entnehmen ist – obwohl diese Nazisympathisanten waren.
Friedemann Kawohl, aufgewachsen in Burgsinn und inzwischen wohnhaft im Schwarzwald, ist kürzlich auf der Rienecker Burg das Faltblatt über die drei Rienecker Dichter Walter Bloem sowie Friedrich und Anton Schnack in die Hände gefallen, nach denen auch Straßen benannt sind. Etwas irritiert war der lokalhistorisch Interessierte, weil „alle drei glühende Nazisympathisanten waren“, „dieser wichtige Teil ihrer Biografie“ darin aber überhaupt nicht vorkommt, wie er der Main-Post schrieb. Dabei dürfe dies, „wenn man die drei literarisch rehabilitieren will“, nicht unter den Teppich gekehrt werden, findet er. Tatsächlich ist in besagtem Faltblatt die Zeit des sogenannten Dritten Reiches völlig ausgeblendet. Welche Rolle spielten sie damals?
Der Rienecker Ehrenbürger Walter Bloem (1868–1951), geboren in Wuppertal-Elberfeld, war ohne Zweifel der erfolgreichste der Drei. Über ihn gibt es mehrere Biografien, darunter die neueste, sehr aufschlussreiche Peter Stauffers von 2009. In den Jahren 1912 bis 1922 war Bloem der vielleicht meistverkaufte Schriftsteller in Deutschland. Der Jurist war kein Goethe, eher ein Konsalik, aber er wurde zum Lieblingsschriftsteller Kaiser Wilhelms II.
Mit der Verherrlichung militärischen Heldentums und Opfermutes war Bloem gewissermaßen ein Kriegsgewinnler. Seine Romantrilogie über den Krieg 1870/71 wurde sein Durchbruch, sein wohl wichtigstes Werk waren die 1916 unter dem Titel „Vormarsch“ erschienen Weltkriegserinnerungen. Letzteres ist sogar ins Englische übersetzt worden und wird in Großbritannien jetzt im Oktober neu aufgelegt.
Mit Rieneck verbindet ihn, dass er dort ab 1916 Burgherr war. Der Millionär tat sich als Wohltäter hervor, er stiftete neue Kirchenglocken und wurde 1929 Ehrenbürger. Ab 1922 ging es wirtschaftlich jedoch bergab. Die Kriegsbegeisterung war vorbei. Nationale Kreise und Burschenschaften nahmen ihm das Buch „Brüderlichkeit“, in dem er sich gegen Antisemitismus verwahrt und einen Rassisten negativ darstellt, übel. Die Auflagenzahlen sanken unwiderruflich, die Inflation tat ihr übriges. 1929 musste er die Burg für ein Zehntel des Kaufpreises verkaufen und nach Berlin ziehen.
„Der Führer weiß, was er tut.“
Walter Bloem zur Verfolgung der Juden
Der Verbitterte und Ausgegrenzte beschimpfte Erich Maria Remarques Welterfolg „Im Westen nichts Neues“ als Dreck und eine Beleidigung des Frontkämpfertums. In einem offenen Brief im September 1932 wütete er auch gegen Heinrich Mann. Leute wie dieser sollten sich vorsehen: Michel sei erwacht und schicke sich an, „in seinem Hause Großreinemachen zu veranstalten“. Seine Rhetorik und seine Haltung näherten sich immer mehr der der Nazis an. Bloem wurde zu einem glühenden Hitler-Verehrer und freute sich auf die Herrschaft der Nazis. Seine Rolle in dieser Zeit war nicht sonderlich ruhmreich.
Am 1. April 1933 soll er in Wuppertal Mitinitiator einer der ersten Bücherverbrennungen in Deutschland gewesen sein. Landesweit brannten die Bücher erst im Mai. Bloem spielte auch bei der Umformung des politisch neutralen Schutzverbands Deutscher Schriftsteller in eine parteitreue Schriftstellervereinigung eine wichtige Rolle. Er wurde Ehrenvorsitzender. Auf ein Hilfegesuch des bekannten Schriftstellerkollegen Erich Mühsam, hat Bloem nicht einmal geantwortet; Mühsam wurde 1934 im KZ Oranienburg ermordet.
Als Autor spielte er in der Nazizeit kaum eine Rolle, aber er schrieb den Nazis nach dem Mund. So fabulierte er von der Überlegenheit der weißen Rasse. Seinen Roman „Brüderlichkeit“ verleugnete Bloem fortan und seine veränderte Sicht auf die Juden begründete er 1935 unter anderem folgendermaßen: Juden, für die er sich eingesetzt habe, nämlich „nationaldeutsche Juden“, gebe es nur zu einem sehr kleinem Prozentsatz. 1921 war er bei einem Treffen einer Burschenschaftsvereinigung noch der einzige gewesen, der dagegen war, Juden auszuschließen.
Vor Hitlers Judenpolitik verschloss er die Augen. Als er in Berlin seinen jüdischen Zahnarzt mit dem gelben Stern auf dem Straßendamm gehen sah, sei er zwar errötet, aber habe sich gedacht: „Der Führer weiß, was er tut.“ Er rechtfertigte „Härte, Grausamkeit und Zerstörungswillen“ der Nazis. Interessanterweise wurde er erst 1938, auf persönliche Intervention Goebbels', in die NSDAP aufgenommen.
1941 schrieb er in einem Gedicht: „Mein Führer! In der Symphonie deines Werkes töne ich mit;/so will ich kein Mißton sein./In der Kraft deines Schwertes bin auch ich enthalten./So will ich ein edles Stahlmolekül darin sein.“ Das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 nannte er eine „Rattentat“ und änderte seine Meinung auch nicht, als er erfuhr, dass unter den Hingerichteten auch Ulrich von Hassel war, mit dem er sich zwei Wochen zuvor noch glänzend unterhalten hatte. Ende März 1945 schrieb Bloem noch eine Durchhalteparole, die in verschiedenen Zeitungen erschien. Darin war etwa die Rede von den „judenhörigen Slawen Lenin und Stalin“.
Und die aus Rieneck stammenden Brüder Anton und Friedrich Schnack? Sie waren, wie Bloem und übrigens auch Leo Weismantel, unter den 88 Schriftstellern, die am 26. Oktober 1933 in der Vossischen Zeitung Hitler „das Gelöbnis treuester Gefolgschaft“ leisteten. Es ist natürlich möglich, wie der Lokalhistoriker Heinz Scheid aus Karlburg vermutet, dass sie nur unterschrieben, damit die Nazis sie in Ruhe ließen oder um ihre Verleger zu stützen.
Friedrich (1888–1977) gehörte zunächst zu den Vorzeigeschriftstellern des „Dritten Reiches“, einige seiner Bücher hatten sehr hohe Auflagen. Die Brüder zogen sich jedoch während der Nazizeit aus dem Literaturbetrieb weitgehend zurück, wählten die „innere Emigration“. Anton (1892–1973) trat aber immerhin mit mehr als 50 Texten im „NS-Kampfblatt“ (laut „Kulturlexikon zum Dritten Reich“) Krakauer Zeitung in Erscheinung, aber von irgendetwas musste er wohl leben. Friedrich erhielt 1965 den Bayerischen Verdienstorden. Heute sind die Brüder fast vergessen.
Auch Bloem ist heute fast vergessen. In Rieneck allerdings bewahrt „man ihm bis heute ein ehrendes Gedenken“, wie dem Faltblatt zu entnehmen ist. Tatsächlich wurde er am 24. August 1951 in Rieneck feierlich begraben. Im Raum der Ehrenbürger und Schriftsteller kann man Bilder, Bücher und Persönliches der Rienecker Autoren besichtigen.
Vor zehn Jahren, zum 50. Todestag Bloems, gab es in Rieneck eine Diskussion, ob man ihm die Ehrenbürgerwürde entziehen solle. Da ihm diese bereits 1929 verliehen worden sei, so der damalige Rienecker Bürgermeister Walter Höfling 2001 anlässlich einer Feierstunde, habe es keinen Grund gegeben, sie Bloem wieder zu entziehen. 1929 sei dieser kein Nazi gewesen, sagte Höfling, dessen Unterschrift auf dem Faltblatt steht, damals.
Der jetzige Rienecker Bürgermeister Wolfgang Küber sagt, dass die Stadt nichts unter den Teppich kehren will. Man wolle sich generell einmal mit der Zeit des Nationalsozialismus in Rieneck und etwa dem Schicksal der Juden der Stadt befassen, dann könne man auch das Kapitel im Leben der Rienecker Dichter einmal näher beleuchten. Das Ergebnis könnten Informationstafeln sein, sagat Bürgermeister Küber.