Nur knapp 100 Meter liegen dazwischen. Keine zwei Minuten Fußweg. Heute. Wie vergessene Schachfiguren flankieren die beiden weißen Türme den ehemaligen Grenzstreifen. Der Wind peitscht die Wolken über die Gipfel des Hessischen Kegelspiels. Regen nieselt, die Schuhe rutschen leicht auf dem alten Kolonnenweg. Es ist kühl. Berthold Dücker beschleunigt seine Schritte. Früher waren diese 100 Meter unüberwindbar. Genau hier verlief die innerdeutsche Grenze. Genau hier, am sogenannten Point Alpha zwischen Rasdorf (Hessen) und Geisa (Thüringen), standen sich bis 1989 NATO und Warschauer Pakt unmittelbar gegenüber. Und genau hier hätte jederzeit der Dritte Weltkrieg ausbrechen können, sagt Dücker.
Der 71-Jährige bleibt stehen, dreht sich weg von den Grenztürmen und zeigt über die bewaldeten Kuppen nach Osten. "Dort liegt mein Ort." Geismar in Thüringen. Dort wurde Dücker 1947 geboren, von dort floh er mit 16 Jahren in den Westen. Allein. Wenige Kilometer entfernt von der Stelle, an der heute die Gedenkstätte Point Alpha steht. Ein Erinnerungsort deutscher Geschichte, ein Schicksalsort für Dücker. Den es ohne ihn nicht mehr geben würde.

Es ist der 24. August 1964. Berthold Dücker hat kurz zuvor die Schule beendet. Er will Journalist werden, soll aber zum Elektromonteur ausgebildet werden. Undenkbar für den 16-Jährigen. Er entschließt sich zur Flucht. Noch im Blaumann und nur mit einer Kneifzange ausgerüstet nährte er sich der Grenze. Am helllichten Tag durchschneidet er den ersten Zaun, schiebt sich auf dem Bauch liegend durch das Minenfeld. Den Kopf auf dem linken Unterarm, mit rechts die Zange in den Boden stoßend, in der Hoffnung, Minen aufzuspüren bevor sie ihn zerfetzen.
"Was mich erschüttert, ist, dass es wieder Politiker gibt, die meinen, durch neue Grenzen, Mauern und Schießbefehle verhindern zu können, dass Menschen einen Weg in Frieden und in die Freiheit suchen."
Berthold Dücker, Gründer der Gedenkstätte Point Alpha
"Das war natürlich der nackte Irrsinn. Meine Brüder können mir das bis zum heutigen Tag nicht verzeihen", sagt Dücker. Mit einer "Heerschar von Schutzengeln" schafft er es durch die Minen, durchs freie Schussfeld, über die Grenze. Er ist im Westen. Frei. Wird Journalist, in Fulda, Hildesheim, Kassel, München. Später Chefredakteur. Und schließlich Gründer der Gedenkstätte Point Alpha.

Dücker atmet aus. Sein Leben hat er unzählige Male erzählt. Bewusst. Vor allem jungen Leuten. Vor allem heute wieder. "Was mich erschüttert, ist, dass es wieder Politiker gibt, die meinen, durch neue Grenzen, Mauern und Schießbefehle verhindern zu können, dass Menschen einen Weg in Frieden und in die Freiheit suchen. Es ist nie gelungen und wird auch niemals gelingen."
Es ist die Aufarbeitung der deutsch-deutschen Geschichte, die so sehr seine eigene ist, mit der Dücker hadert. Das allzu bereitwillige Vergessen, das ihn auch drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch die Stimme erheben lässt. Der 71-Jährige deutet auf den schmaleren der beiden weißen Türme. "Mahnmal Deutscher Geschichte" prangt darauf. Er war ein Teil der DDR-Grenzsperranlagen, steht unter Denkmalschutz. Obendrauf aber, sagt Dücker, durfte eine Mobilfunkgesellschaft ihren Mast anbringen. Der große Mann mit der Baskenmütze schüttelt den Kopf. Absurd. Und fast schon symbolisch für den Umgang mit der Gedenkstätte.
Der Observation Post Point Alpha war bis 1989 einer der wichtigsten Beobachtungsstützpunkte der US-Streitkräfte in Europa. Auf 411 Metern Höhe in der Rhön bot das Camp einen weiten Blick bis nach Thüringen und erleichterte das Abhören des Funkverkehrs. Hier, mitten im so genannten Fulda Gap, wurde im Ernstfall der Aufmarsch der Truppen des Warschauer Paktes erwartet. "Es war wirklich ein Hot-Spot", sagt Dücker. Wäre aus dem Kalten Krieg ein heißer geworden, dann an dieser Stelle. "Das heutige Biosphärenreservat Rhön wäre auf einen Schlag verschwunden gewesen."
30 Jahre nach dem Mauerfall heißt der Ort Gedenkstätte. "Lernort der Geschichte", nennt ihn Dücker. Drei Grenzkilometer bedrückende, eindrückliche, teils eben auch absurde Erinnerung.

Im ehemaligen Osten steht das "Haus auf der Grenze". Ausstellungen zeigen den Weg vom Aufbau des Todesstreifens bis hin zur friedlichen Revolution. Selbstschussanlagen sind zu sehen. Zwei schwarz-weiße Kreuze mit Fotografien gescheiterter Fluchtversuche – ein 19-Jähriger, von 57 Kugeln getötet. Zeitzeugen erzählen von Zwangsvertreibung und Angst. Kerben in einer Zahnbürste zeugen von Monaten in Gefangenschaft. Auch Berthold Dückers Blaumann und seine Kneifzange hängen in einem Schaukasten. Und schließlich das Bild der Großmutter, die 1989 mit ihrer Enkelin durch den zerschnittenen Grenzzaun erstmals den Westen betritt. Jubelnde Menschen. Einheit.
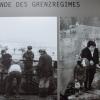
"Ich hätte nie daran geglaubt", sagt Dücker. Daran, dass die Grenze, die er einst mit so viel Glück als jugendlicher Flüchtling überwunden hat, verschwindet.
Weiße Pfosten mit roten Spitzen kennzeichnen, wo genau Ost- und Westdeutschland aufeinander stießen. Entlang des Kolonnenweges, auf dem damals DDR-Grenztruppen patrouillierten, hat der Gedenkstätten-Verein original Grenzanlagen restauriert oder rekonstruiert. Die beiden weißen Wachtürme. Stacheldrahtzäune. Fahrzeugsperren aus Betonplatten. Minenfelder natürlich ohne Minen.

Warnten früher auf den Wegen ringsum Schilder vor dem nahen Todesstreifen, sind sie längst ersetzt durch Wegzeichen für Rhön-Wanderer. Naturidylle. Dücker macht einen großen Schritt und ist drüben. Beiläufig. Nein. "Manchmal überquere ich die ehemalige Grenze drei-, vier-, fünfmal am Tag. Und jedes Mal bewegt sich in meinem Innern etwas", sagt der 71-Jährige.
Hier, auf der anderen Seite der Grenze, liegt das wiederaufgebaute US-Camp. Von hier aus wurde in den Osten gespäht und gelauscht. Jeweils um die 40 Soldaten lebten während des Kalten Krieges in dem Stützpunkt, meist rund vier Wochen lang. Ein Zaun umfasst das Gelände, im Wald stehen Panzer und Armeefahrzeuge.
In Baracken wird das Camp-Leben dokumentiert. Einfache Stockbetten, Militärjacken, Bilder von Pin-Up-Girls an der Schrankwand. Fotografien von Soldaten in der Bütt oder als Santa Claus an Weihnachten. Gleichzeitig aber auch originale militärische Geräte, Angriffs- und Verteidigungspläne. Alltag und Einsatz. Und ein Modell, das rekonstruiert, was damals alle fürchteten: das Fulda Gap als Schlachtfeld zwischen Ost und West.

2005, erzählt Dücker, zur Verleihung des ersten Point-Alpha-Preises, stand er mit Helmut Kohl, Michail Gorbatschow und Georg Bush senior vor dem Schaukasten. Wäre es so gewesen, habe er die drei Männer gefragt, hätte ein Angriff so ausgesehen? Der Zusammenstoß zwischen amerikanischen und sowjetischen Panzern? Beratungen folgten. Dann die Antwort: "Kompliment, genau so war es".
Draußen, vor den Baracken, verläuft die rote Sperrlinie. Sie durfte kein amerikanischer Panzer Richtung Grenze überfahren, das hätte als Provokation aufgefasst werden können. Plötzlich hallt eine blecherne Stimme über den Platz. Ein Junge steht vor einer Hörstation. Verteilt über das Camp, geben sie Erzählungen der Grenzsoldaten wieder. Denn neben historischer Dokumentation geht es in der Gedenkstätte vor allem um die Menschen. Um das, was Leben mit und an der Grenze hieß.

Einmal, sagt Dücker, sei ein US-General zu Besuch gewesen und wollte unbedingt auf den rekonstruierten Wachturm steigen. "Er kam mit verweinten Augen wieder runter und hat erzählt, er habe seinen Jungs damals immer gesagt, sie wären die ersten Opfer gewesen", sagt Dücker.
Gut drei Kilometer vom Camp entfernt liegt das hessische Rasdorf. Point-Alpha-Gemeinde darf sich der 1750-Einwohner-Ort seit einigen Jahren nennen. Berthold Jost, heute Vorstandsmitglied der Point Alpha Stiftung, war dort 21 Jahre lang Bürgermeister, bis 1994. "Die Amerikaner waren gerne gesehen", sagt der CDU-Politiker. Es gab eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Soldaten. Viele kamen mittags ins örtliche Café zum Essen. Oder abends in den Border Saloon, die Diskothek. Jost grinst: "Aus Rasdorf gibt es viele Ehen, die da geschlossen wurden".

Auch seine eigene Geschichte ist eng mit der Grenze, mit der Gedenkstätte verknüpft. Ein Teil seiner Familie lebte in Thüringen, der andere in Hessen. Bedrückend sei das schon gewesen, sagt Jost. Dass es zum Mauerfall kommt, "das hat man immer gehofft". Aber geglaubt? 1989 "ging es dann so schnell". Am Abend des 9. November "hatten wir noch Sitzung bei uns im Rathaus und ich habe das gar nicht mitbekommen". Am nächsten Morgen standen schon die ersten Besucher in seinem Büro und wollten ihr Begrüßungsgeld abholen. Als er dann wenige Tage später zum ersten Mal mit dem Auto von Rasdorf den Berg nach Buttlar in Thüringen runter fuhr, "das war für mich auch …". Er stockt. Noch immer fehlen die Worte.
Oktober. 30 Jahre später. Kurz nach dem Tag der deutschen Einheit, schmücken große Kränze die Gedenkstätte. Willy Brandts Ausspruch "Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört" ist ebenso in ein steinernes Denkmal gemeißelt wie der Spruch "Wir sind das Volk". Mittlerweile kommen um die 80 000 Besucher pro Jahr nach Point Alpha. Touristen, Zeitzeugen, Schulklassen. 87 Prozent von letzteren aus westlichen Bundesländern – nur 13 Prozent aus Thüringen, sagt Jost. "Da haben wir noch vielfältige Aufgaben."
"Hier macht seit Jahren ein Verein etwas, was eigentlich staatliche Aufgabe ist."
Berthold Dücker über fehlende Unterstützung seitens der Politik
Da ist sie wieder, die Kritik am Umgang mit der deutschen Geschichte, mit Point Alpha. In den 1990er Jahren sollten die Gebäude abgerissen und das Gelände "plattgemacht werden", sagt Berthold Dücker. "Keiner hat sich dafür interessiert." Wut blitzt in den dunklen Augen auf. Er, inzwischen Chefredakteur der Südthüringer Zeitung, nahm das nicht hin. Dücker kämpfte für den Erhalt. Bei Politikern vor allem in Hessen sei er auf brüske Ablehnung gestoßen. Erst mit Unterstützung aus Thüringen konnte der Gedenkstätten-Verein gegründet werden. Dücker wurde Vorsitzender, das Gelände kam unter Denkmalschutz. 2008 entstand die Point-Alpha-Stiftung, um die Finanzierung zu sichern. Trotzdem sei Geld nach wie vor knapp, sagt Dücker. "Hier macht seit Jahren ein Verein etwas, was eigentlich staatliche Aufgabe ist."
Erinnern. Vielleicht warnen. Darum geht es. Geschichte erlebbar machen.
Ein Mädchen steht mit seiner Mutter auf dem Beobachtungsturm im US-Camp. Genau gegenüber ragt der DDR-Grenzturm auf. Dass Soldaten hier lauschten, mit Fernrohren jede Regung auf der anderen Seite überwachten, dass Selbstschussanlagen und Grenzer Menschenleben auslöschten – schwer vorstellbar ist das heute. Surreal.
Und doch lässt sich genau hier eine Ahnung bekommen davon, wie es war.
- Lesen Sie auch: Wie 1989 in der Hammelburger Kaserne 8000 Flüchtlinge betreut wurden
- Grenzstreit: Warum Thüringer Rinder nicht in Bayern grasen durften
